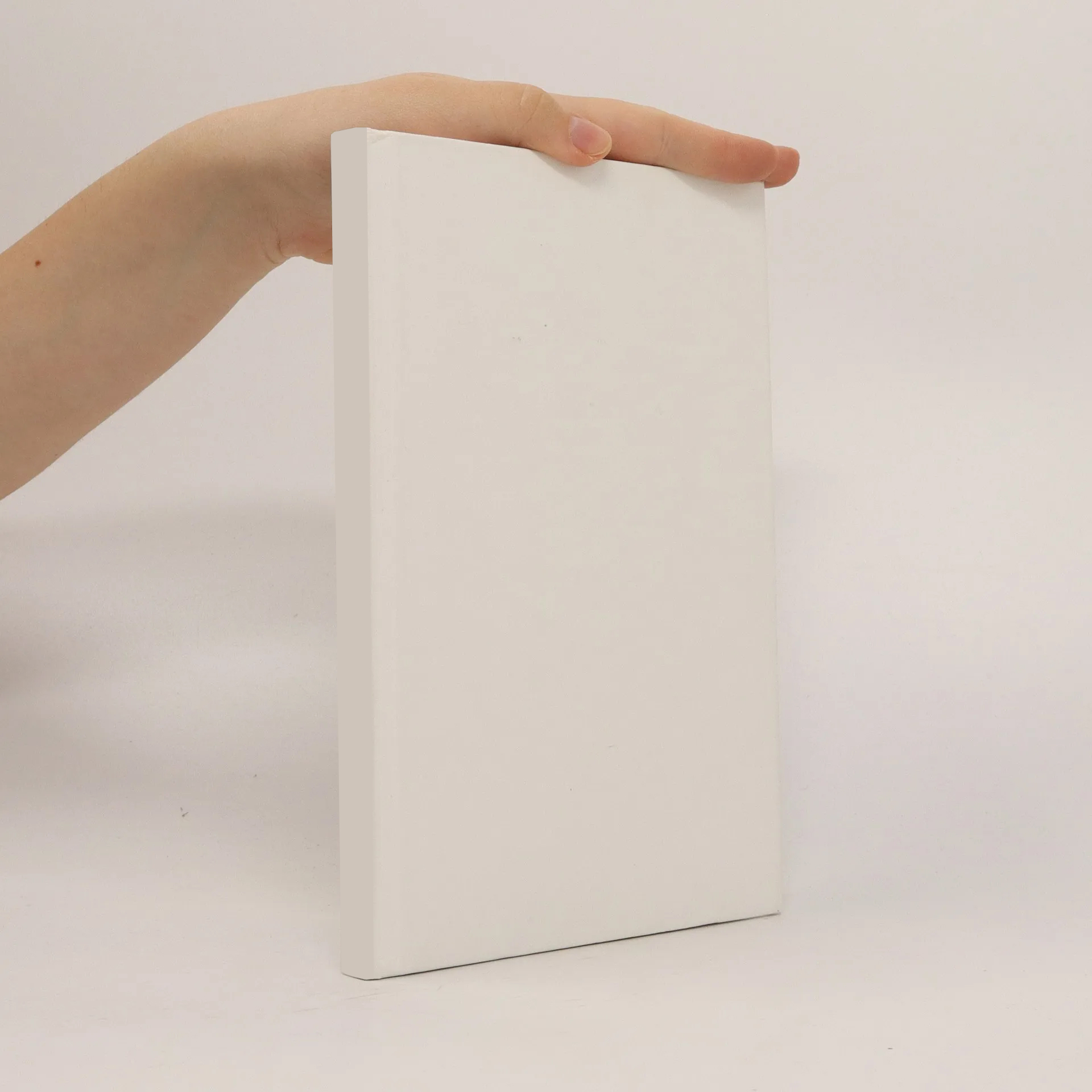
Die Etablierung des interdisziplinären palliativmedizinischen Konsildienstes am Universitätsklinikum Aachen
Autoren
Mehr zum Buch
Hintergrund: Seit den 1970er Jahren wurden an Krankenhäusern weltweit palliativmedizinische Konsildienste etabliert, um Primärärzte bei der Betreuung von Patienten in palliativer Situation zu unterstützen. Ein solches Angebot in interdisziplinärer Form wird am Universitätsklinikum Aachen seit 2006 angeboten. In wiederholt stattfindenden Konsilbesuchen von Palliativärzten und –pflegekräften sollen die körperlichen, psychosozialen und spirituellen Probleme behandelt werden. Fragestellung: Diese Studie untersucht die Mechanismen und Prozesse, die von der Konsilanforderung bis zum erfolgreichen Abschluss der palliativen Begleitung führen. Aus den Ergebnissen können Bedürfnisse von Primärärzten, Patienten und Angehörigen abgeleitet werden, die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Angebots aufzeigen. Material und Methode: Als Material der retrospektiven Studie dienen die Aufzeichnungen des Palliativteams aus den Jahren 2006 und 2007, die quantitativ, und qualitativ nach der Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet wurden. Ergebnisse: Von den 427 in die quantitative Auswertung eingeschlossenen Patienten litten 86,7% an einer malignen Erkrankung. Bei den erfassten Symptomen standen Schwäche, Müdigkeit und Appetitmangel im Vordergrund. 54,8% der Patienten wurden im Verlauf der konsiliarischen Begleitung auf die Palliativstation übernommen. Von Aufnahme der Patienten bis zur Konsilanforderung vergingen 14,2 Tage. Primärärzte betonten in ihrer Konsilanforderung häufig den schlechten Allgemeinzustand des Patienten oder die Erfolglosigkeit einer kurativen Therapie. Meist genannter Konsilgrund war die Bitte um Übernahme des Patienten auf die Palliativstation. Zudem fielen hier viele unkonkrete Anfragen nach Mitbehandlung oder gar fehlende Aufträge an das Palliativteam auf. Ein Schwerpunkt der Arbeit des Palliativteams lag in den Gesprächen mit Patienten und Angehörigen, in denen es einerseits häufig um die Klärung medizinischer Fragen ging, aber andererseits ebenso persönliche Gefühle, die im Zusammenhang mit der Situation des Patienten standen, angesprochen wurden. Erschwert wurden viele dieser Gespräche, da Patienten aufgrund ihrer fortgeschritten Erkrankung nur eingeschränkt kommunikationsfähig waren. Die durchgeführten Interventionen waren vielfältig und bestanden unter anderem in Medikamentenempfehlungen, Übernahme auf die Palliativstation, Kommunikation mit Familienangehörigen oder ärztlichem Personal und der Organisation der weiteren Versorgung. Schlussfolgerung: Von Seiten der Primärärzte besteht weiterhin Aufklärungsbedarf hinsichtlich der Aufgaben des Konsildienstes sowie der Eignung der Patienten für eine palliative Mitbehandlung, der dazu führen könnte, dass Patienten in ihrem Krankheitsverlauf viel zu spät an palliative Dienste angebunden, und so das volle Potential des Konsildienstes nicht mehr ausgeschöpft werden kann. Eine deutlichere Darstellung der Kompetenzen des Palliativteams und die Beratung der Primärärzte könnten dazu beitragen, dass zukünftig noch mehr Patienten, Angehörige und Primärteams von dem Angebot des palliativmedizinischen Konsildienst profitieren können.