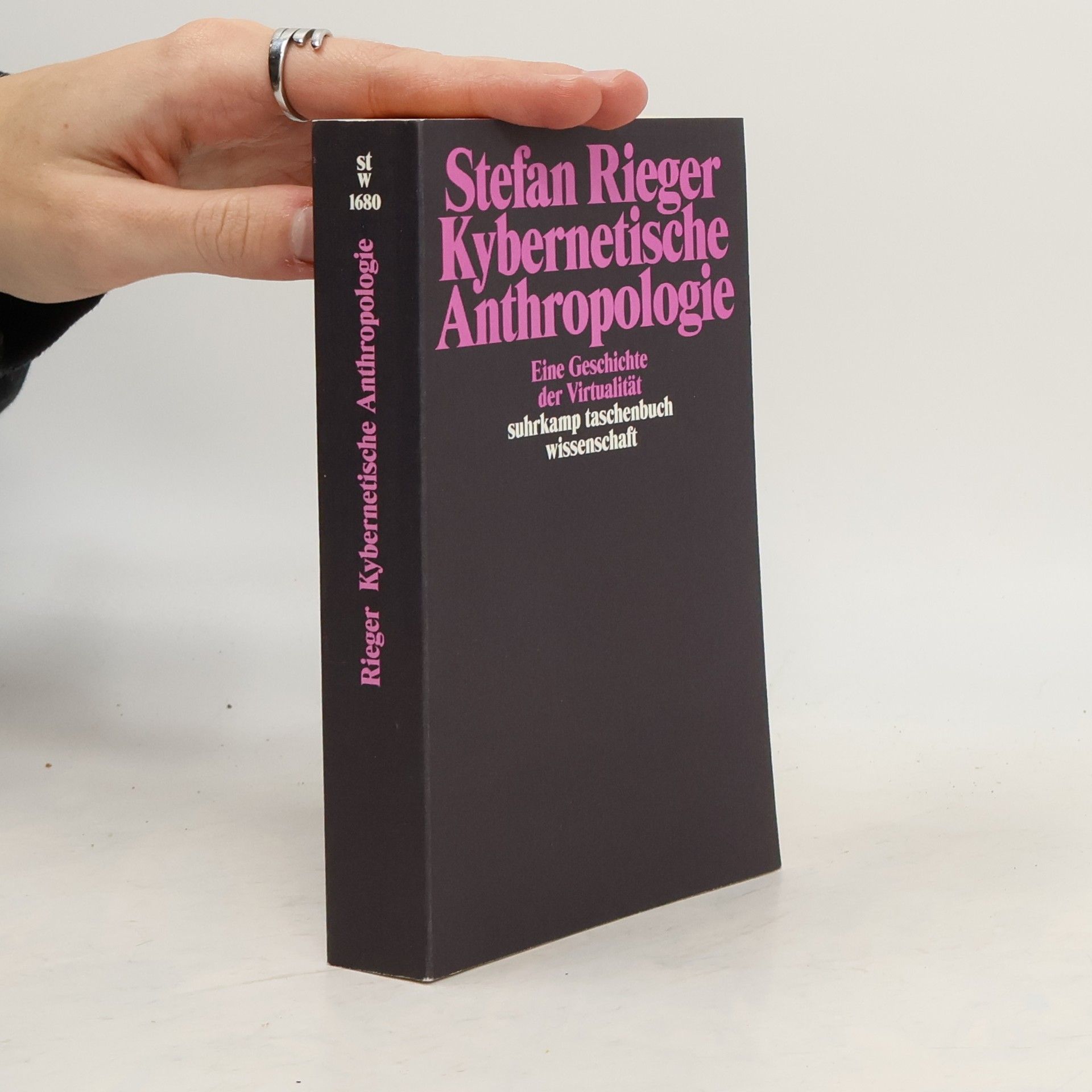Die Individualität der Medien
- 518 Seiten
- 19 Lesestunden
Die Individualität der Medien ist ein aktueller Beitrag zur Diskussion um die neuen Medien. Unternommen wird der Versuch einer medienwissenschaftlichen Fundierung der Kulturwissenschaften oder umgekehrt einer kulturwissenschaftlichen Fundierung der Medienwissenschaften. Dabei werden Anthropologie und Technikentwicklung nicht gegeneinander ausgespielt, sondern in vielfacher Weise miteinander verbunden. Am historischen Material und in der Theorie wird gezeigt, wie technische und anthropologische Aussageformen in einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis stehen und - im historischen Rückgriff - immer schon standen.