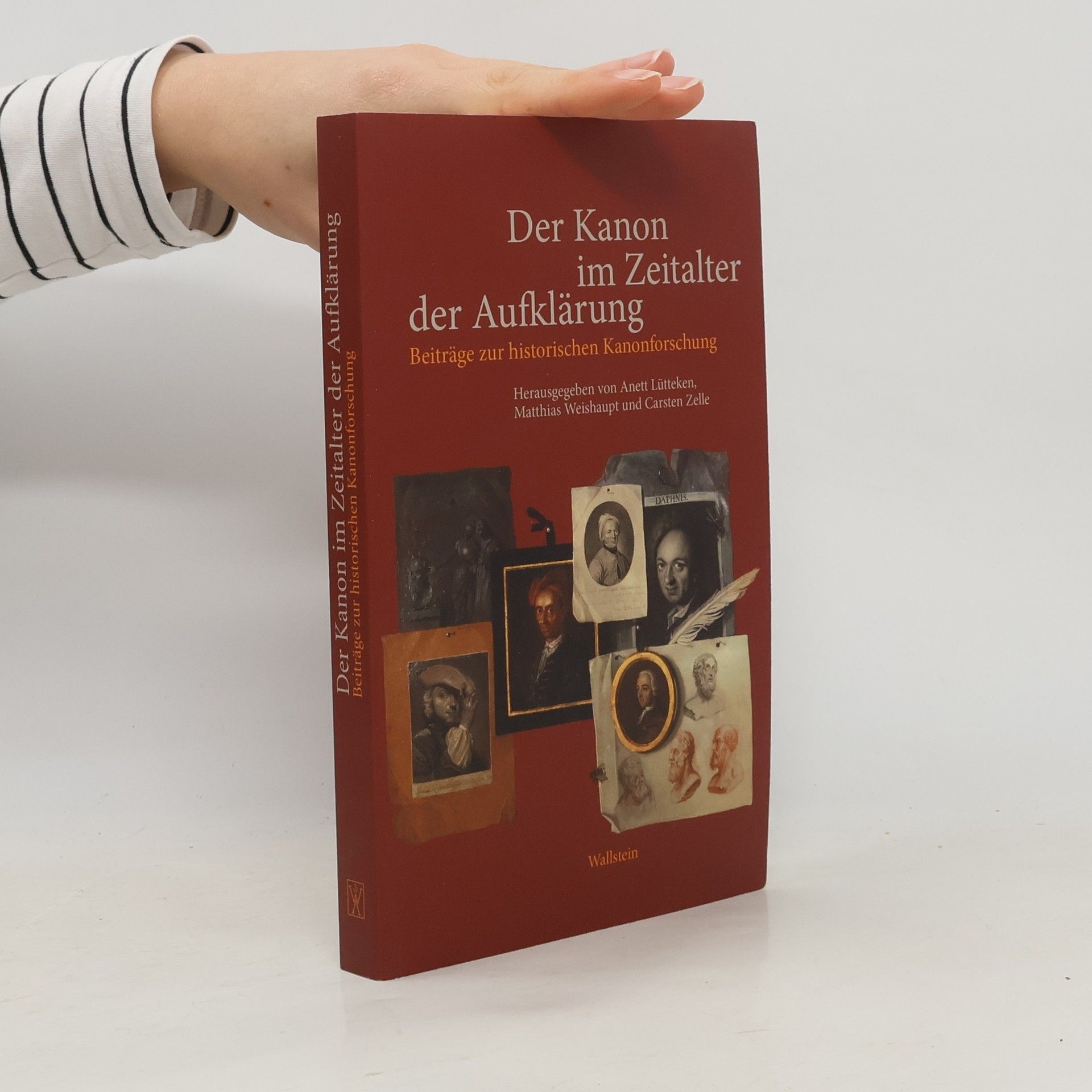Bodmer und Breitinger im Netzwerk der europäischen Aufklärung
- 879 Seiten
- 31 Lesestunden
Zürich im 18. Jahrhundert: Bodmer und Breitinger als Begründer einer neuen intellektuellen Metropole. Ab den 1740er Jahren zog Zürich eine Vielzahl junger deutscher Schriftsteller an. Durch die beiden Hochschullehrer, Schriftsteller, kosmopolitischen Denker und Gesellschaftskritiker Bodmer und Breitinger wurde die Stadt zu einem »Limmat-Athen«. Viele Schriftsteller, die mit dem ästhetischen Klassizismus und dem höfischen Absolutismus unzufrieden waren, blickten hoffnungsvoll nach Zürich und auf das poetologische Programm der beiden Gelehrten: Breitinger wollte die Phantasie als poetische Produktivkraft entfesseln, Bodmer provozierte mit seinem Anspruch, mit Homer und Mose, Milton und Pope, Tasso und Cervantes in einen produktiven Wettstreit zu treten, die Kritik Gottscheds. Zur Zeitschrift: »Das achtzehnte Jahrhundert« wurde 1977 als Mitteilungsblatt der »Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts« (DGEJ 18. J) gegründet und erscheint seit 1987 als wissenschaftliche Zeitschrift. Die Zeitschrift erscheint halbjährlich und ist im Aufsatzteil im Wechsel aktuellen Themen gewidmet oder frei konzipiert. Im Rezensionsteil legt sie Wert auf aktuelle Besprechungen zu einem weit gefächerten Spektrum von thematisch repräsentativen und methodologisch aufschlussreichen Fachpublikationen. Entsprechend der interdisziplinären Ausrichtung der DGEJ enthält sie Beiträge aus allen Fachrichtungen.