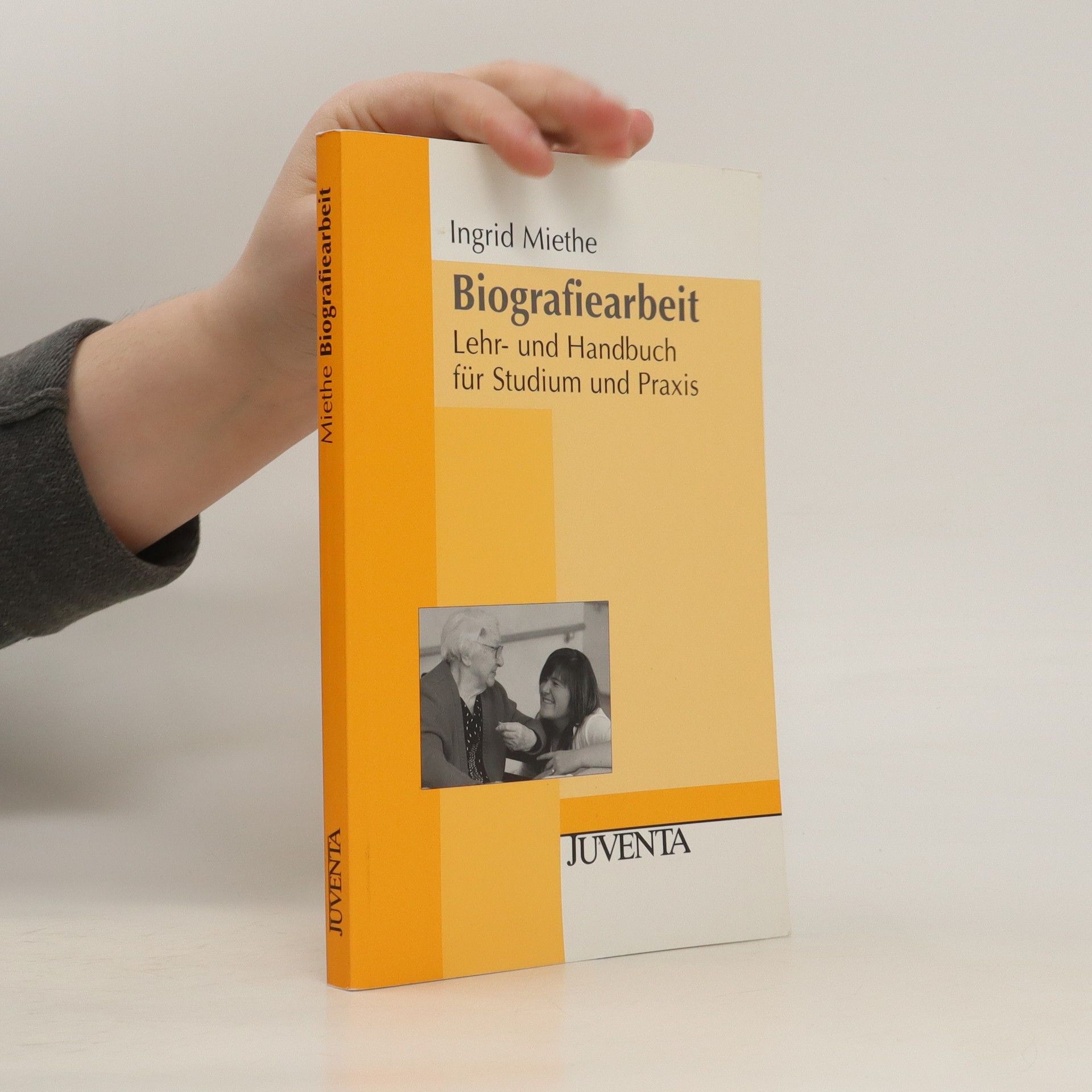Bildungsungleichheit
Von historischen Ursprüngen zu aktuellen Debatten
Welche Grundannahmen liegen der Forderung nach einem Abbau sozialer Ungleichheit zugrunde? Warum ist Ungleichheit im Bildungswesen ein Problem? Ist Bildungsungleichheit überhaupt ein Problem? Solche und ähnliche Fragen werden eher selten gestellt und oft nur implizit beantwortet. Im Buch werden die Welt- und Menschenbilder von „Klassikern“ der Bildungsphilosophie wie Platon, Rousseau und Pestalozzi dargestellt und mögliche pädagogische Konsequenzen gezeigt. So wird eine neue Perspektive auf aktuelle Debatten über Bildung und Ungleichheit gewonnen.