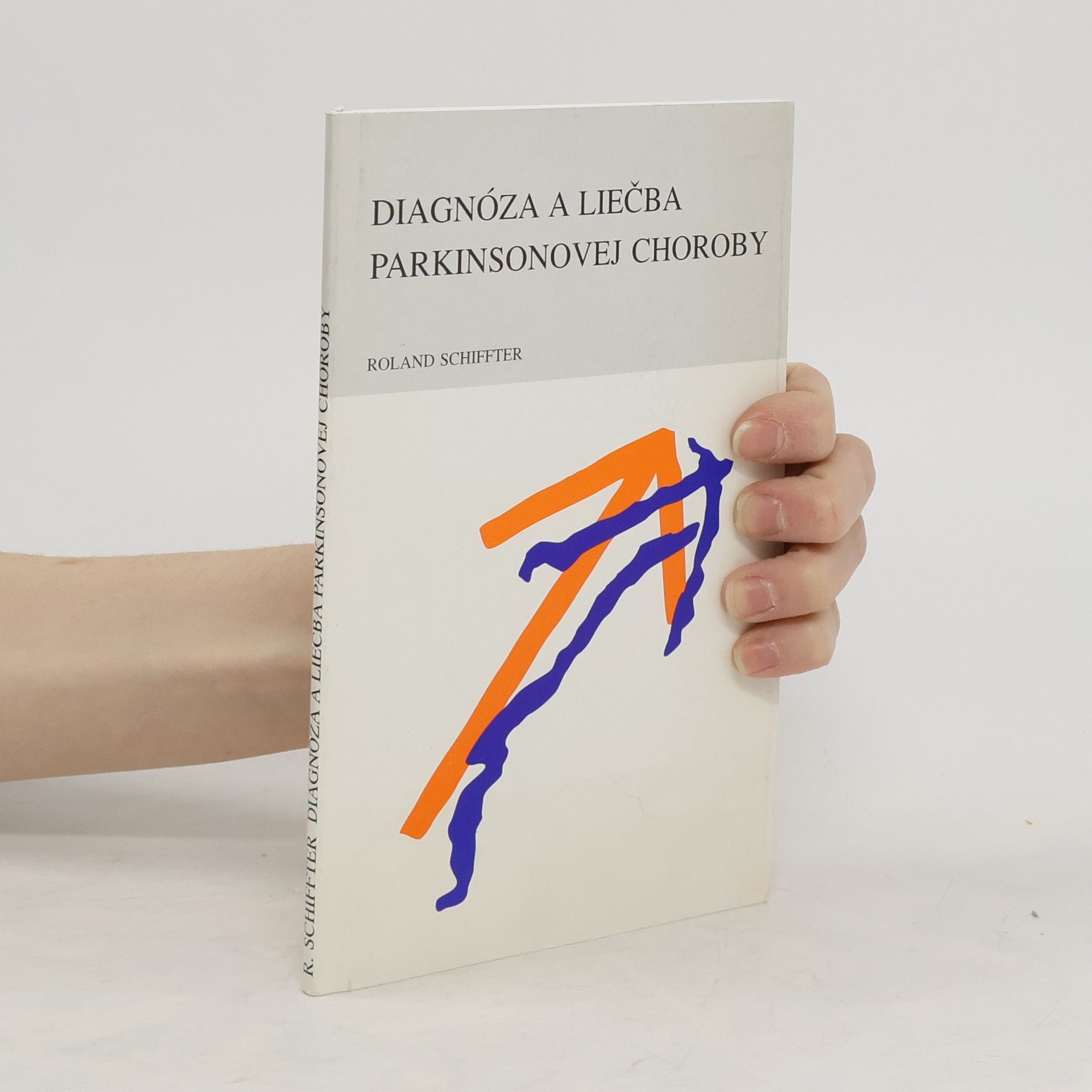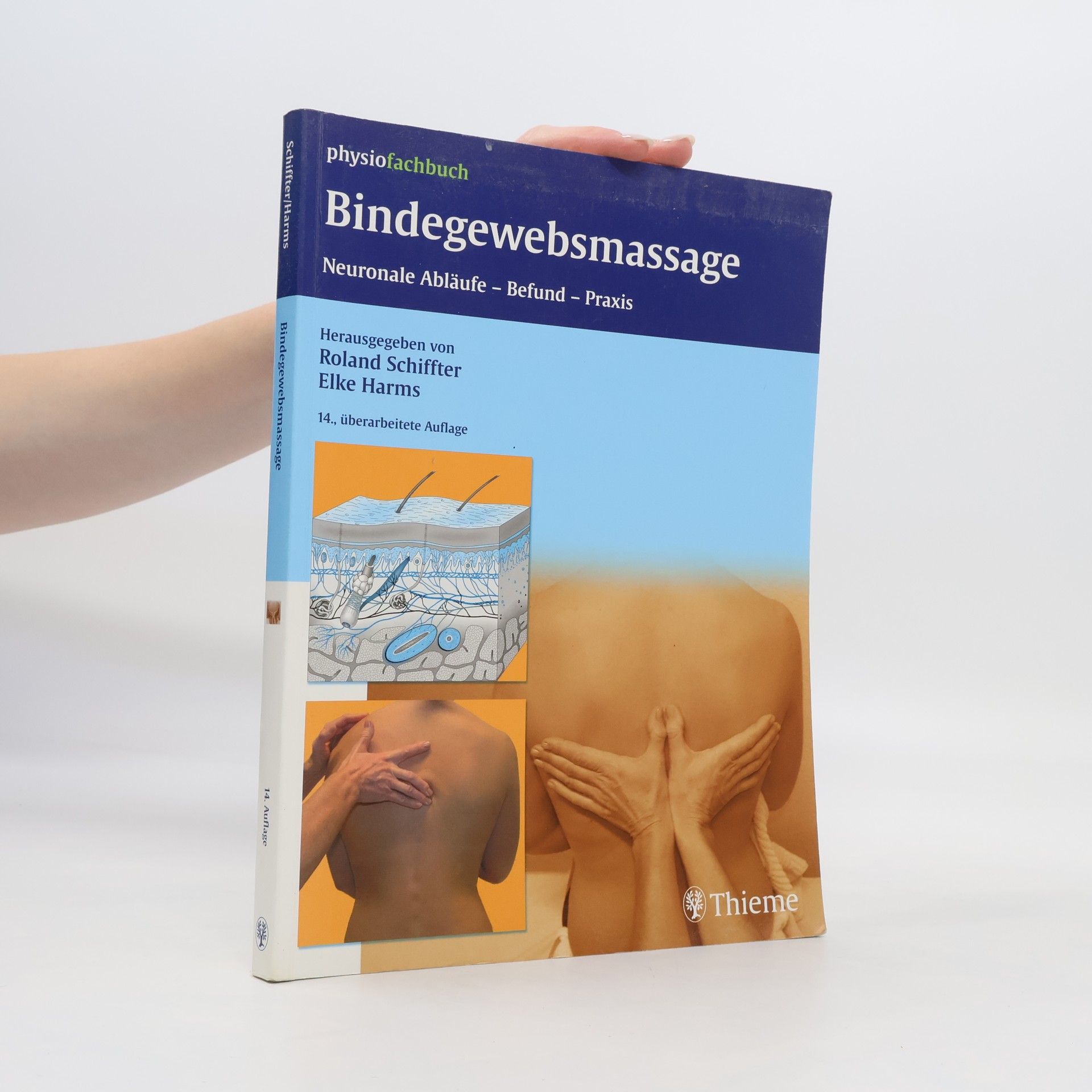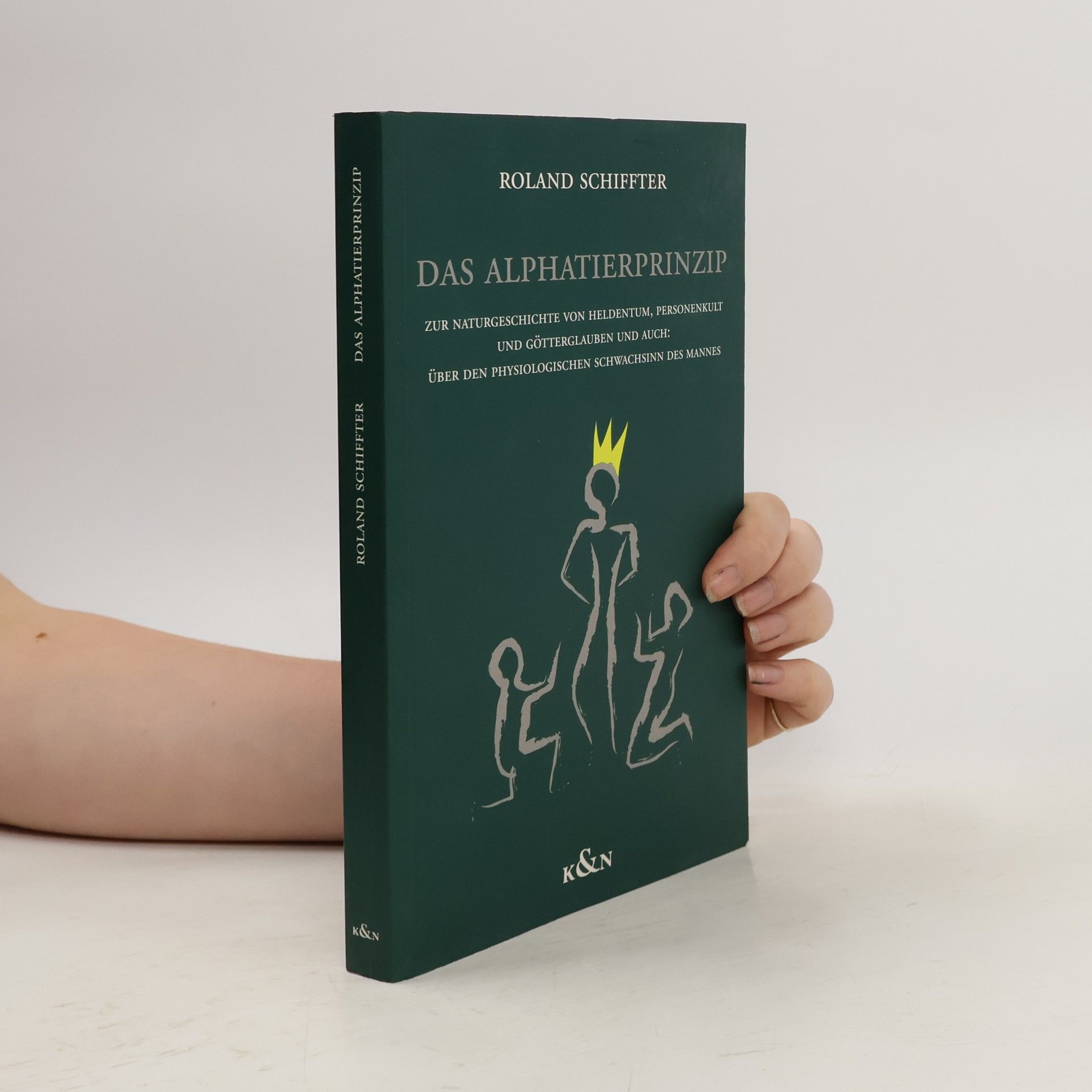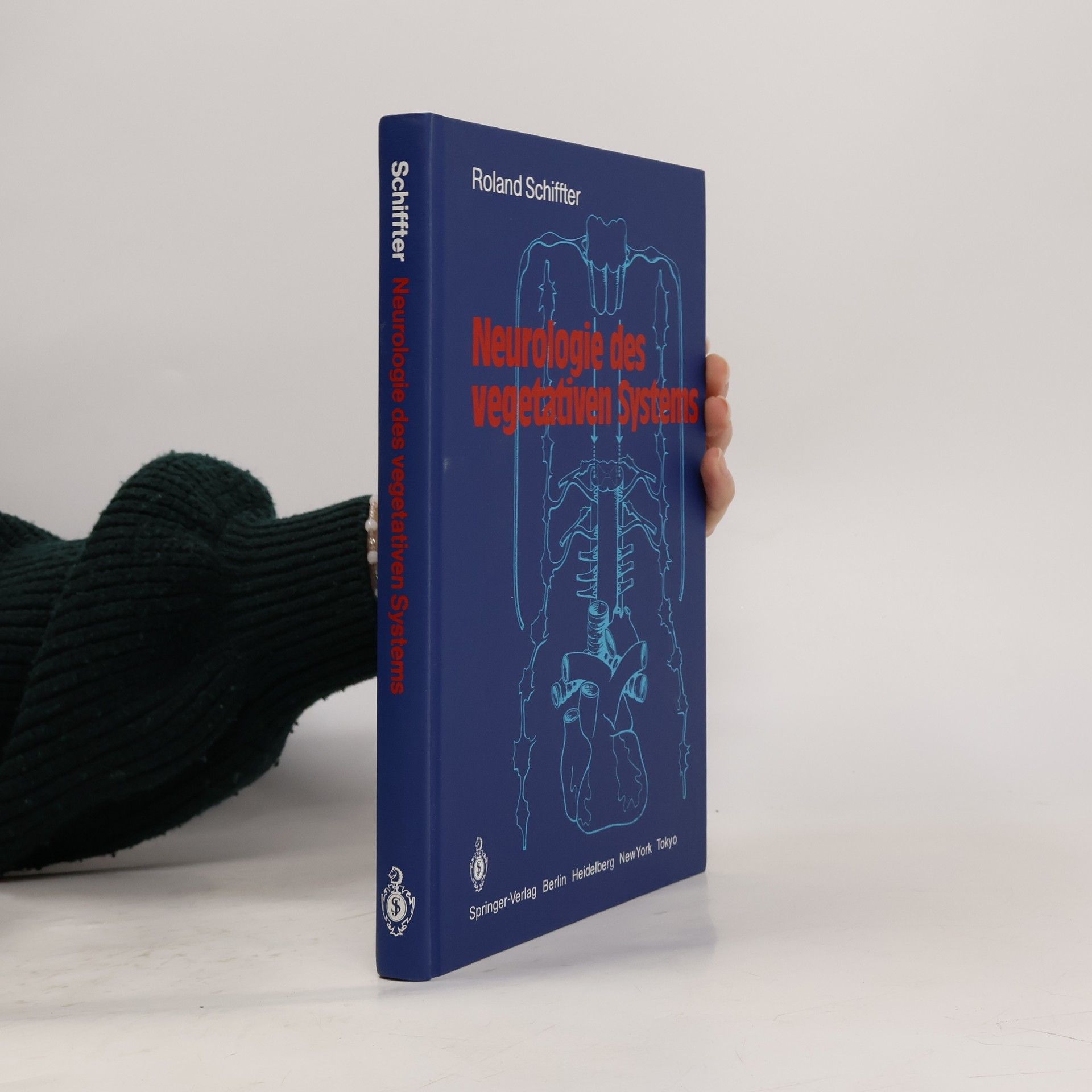Das Alphatierprinzip
- 212 Seiten
- 8 Lesestunden
Das Buch beschreibt ein grundlegendes biologisches Prinzip, das in allen menschlichen Gesellschaften wirksam ist: das Alphatierprinzip. Es wird evolutionsbiologisch aus den Verhaltensmustern der Primaten und frühen Menschen abgeleitet und ist in archaischen Kulturen nachweisbar. Anhand von Beispielen aus Heldengeschichten, Personenkult und Gottesglauben werden die Mechanismen dieses Prinzips erläutert. Dabei werden Einsichten über Rivalität, Dominanzstreben und das menschliche Bedürfnis nach Verehrung von Helden und Göttern gewonnen. Auch die Perversionen dieses Prinzips bei Diktatoren und Kriegern werden thematisiert. Zusätzlich werden ironische Überlegungen zum physiologischen Schwachsinn des dominanzsüchtigen Mannes eingeflochten. Das unbegrenzte Machtstreben, insbesondere bei Männern, sowie die universelle Neigung zu Religionen finden evolutionsbiologische Erklärungen. Ebenso werden die Tendenzen zu Unterdrückung und Grausamkeit beleuchtet, die auftreten, wenn Alphatiere diese legitimieren. Sowohl Krieg und Grausamkeit als auch Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe haben biologische Wurzeln. Es wird betont, dass das Alphatierprinzip erkannt und positiv genutzt werden sollte, während gleichzeitig die Kontrolle über seine Antriebe und die Hemmung seiner Auswüchse erlernt werden muss.