Susanne Stemmler Bücher

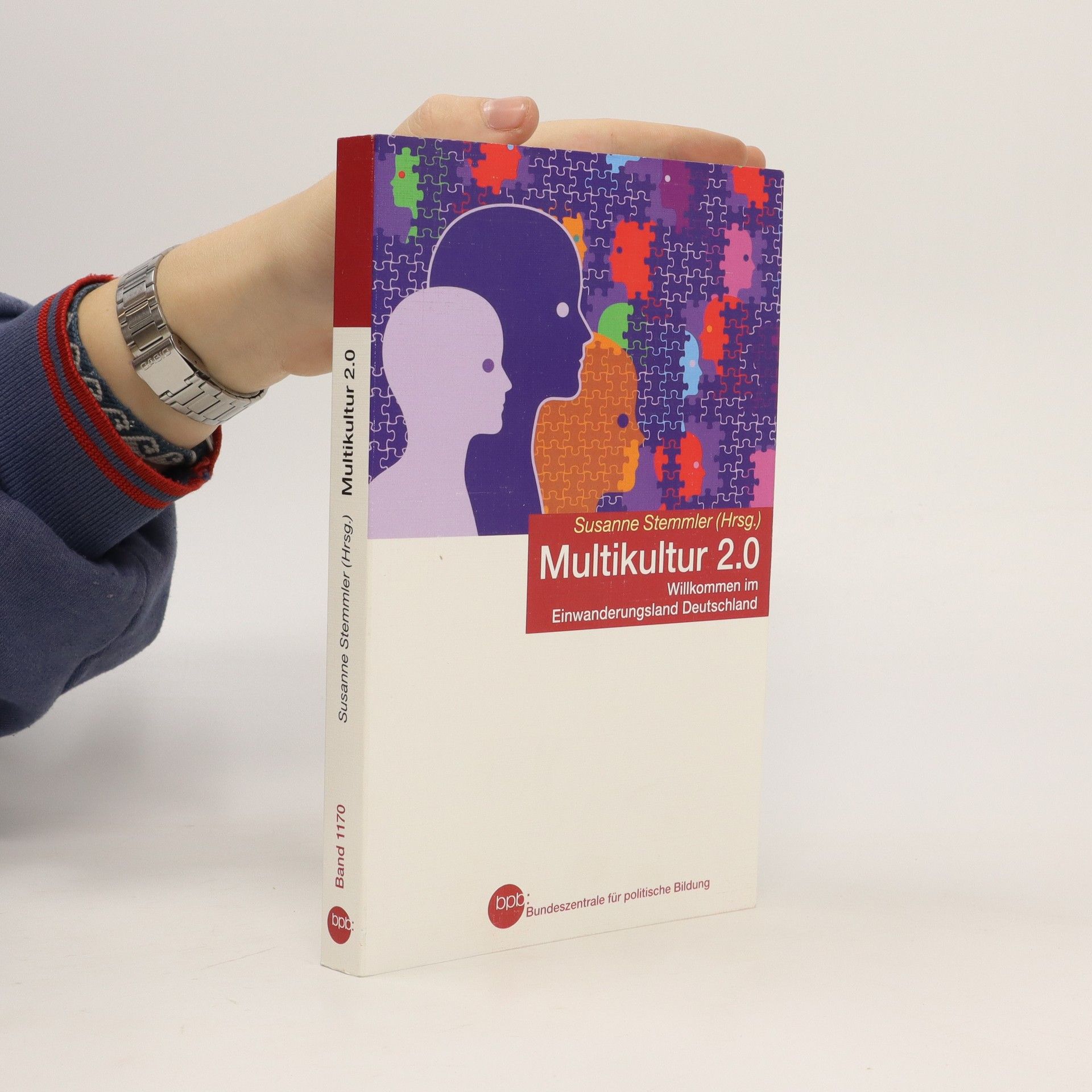
1989 - globale Geschichten
- 300 Seiten
- 11 Lesestunden
Die zwei Jahrzehnte zwischen dem Ende der Ideologien 1989 und der Krise des demokratischen Kapitalismus 2009 stellen eine historisch bedeutende Phase dar. 1989 gilt als Schlüsseljahr des 20. Jahrhunderts, da der Fall der Berliner Mauer weltweite Umbrüche auslöste, deren Folgen bis heute spürbar sind. Dieser Band untersucht die globale Relevanz dieser Ereignisse, darunter das Massaker auf dem Tian’anmen-Platz in China, der Tod Khomeinis im Iran, der Abzug sowjetischer Truppen aus Afghanistan und dessen Auswirkungen auf Zentralasien. In Lateinamerika wird das Ende der Diktaturen und die Durchsetzung des Neoliberalismus thematisiert, ebenso wie der Rückzug kubanischer Truppen aus Angola, die Unabhängigkeit Namibias und das Ende der Apartheid in Südafrika. Diese Ereignisse verschieben den Fokus von Europa und beleuchten die Verflechtungen über nationale Grenzen hinweg. Die Publikation des Hauses der Kulturen der Welt enthält Beiträge namhafter Autoren, die unterschiedliche Perspektiven auf diese globalen Entwicklungen bieten und deren historische Bedeutung analysieren.