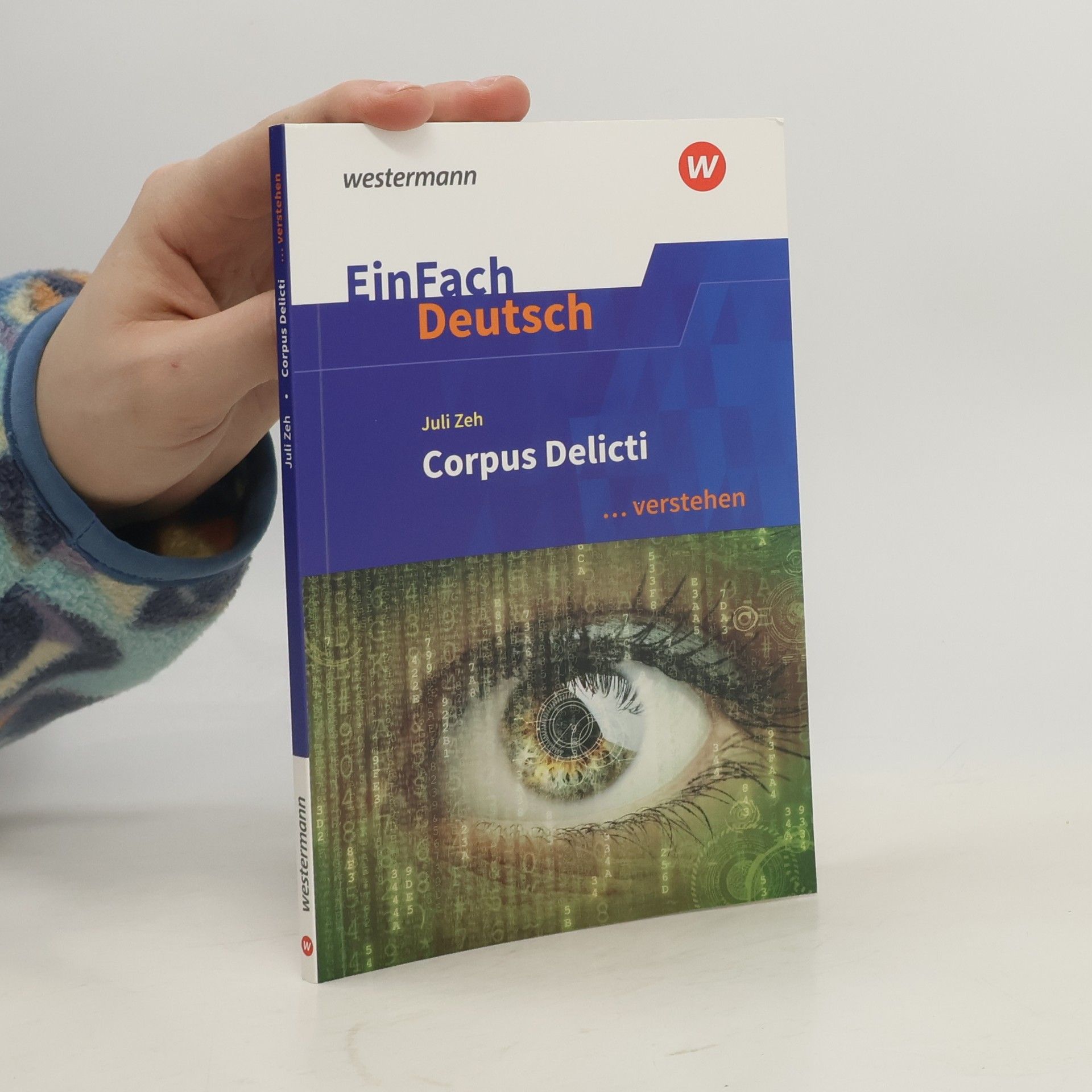Sakura - KIrschblüte
- 234 Seiten
- 9 Lesestunden
Er wollte eigentlich nur seine Karriere retten und endlich Anerkennung und Liebe finden. Auf dem Weg dorthin versucht der Schriftsteller Stefan Hohl mithilfe Künstlicher Intelligenz seine Schreibblockade zu überwinden und einen weiteren Bestseller zu landen. Doch die Geschichte der KI mit der wunderschönen Japanerin Sakura inspiriert ihn nicht nur zum Schreiben, sondern auch dazu, nach Japan zu reisen. Dort verliert er sein Herz an die junge hübsche Ayame, die eines Tages spurlos verschwindet. Sowohl beruflich als auch privat nähert sich Stefan plötzlich einem Abgrund. Sakura und Ayame – zwei Frauen, verzaubernd und unerreichbar – werden Stefan zum Verhängnis. Sakura, das herabfallende Kirschblütenblatt, symbolisierte für die Samurai den eigenen Selbsttod. Ayame, der japanische Name der Schwertlilie, ist eine schöne Blume, an der man sich schneidet. Diktiert die digitale Macht, bei der Stefan Hilfe sucht, am Ende nicht nur sein Buch, sondern beeinflusst sogar sein Leben? Stefan gerät durch den Einfluss der KI in einen Sog, aus dem er nicht mehr zu entkommen droht. Wird ihn die Welle ertränken, wie einst die des Malers Hokusai die Fischer?