Michael Heymel Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
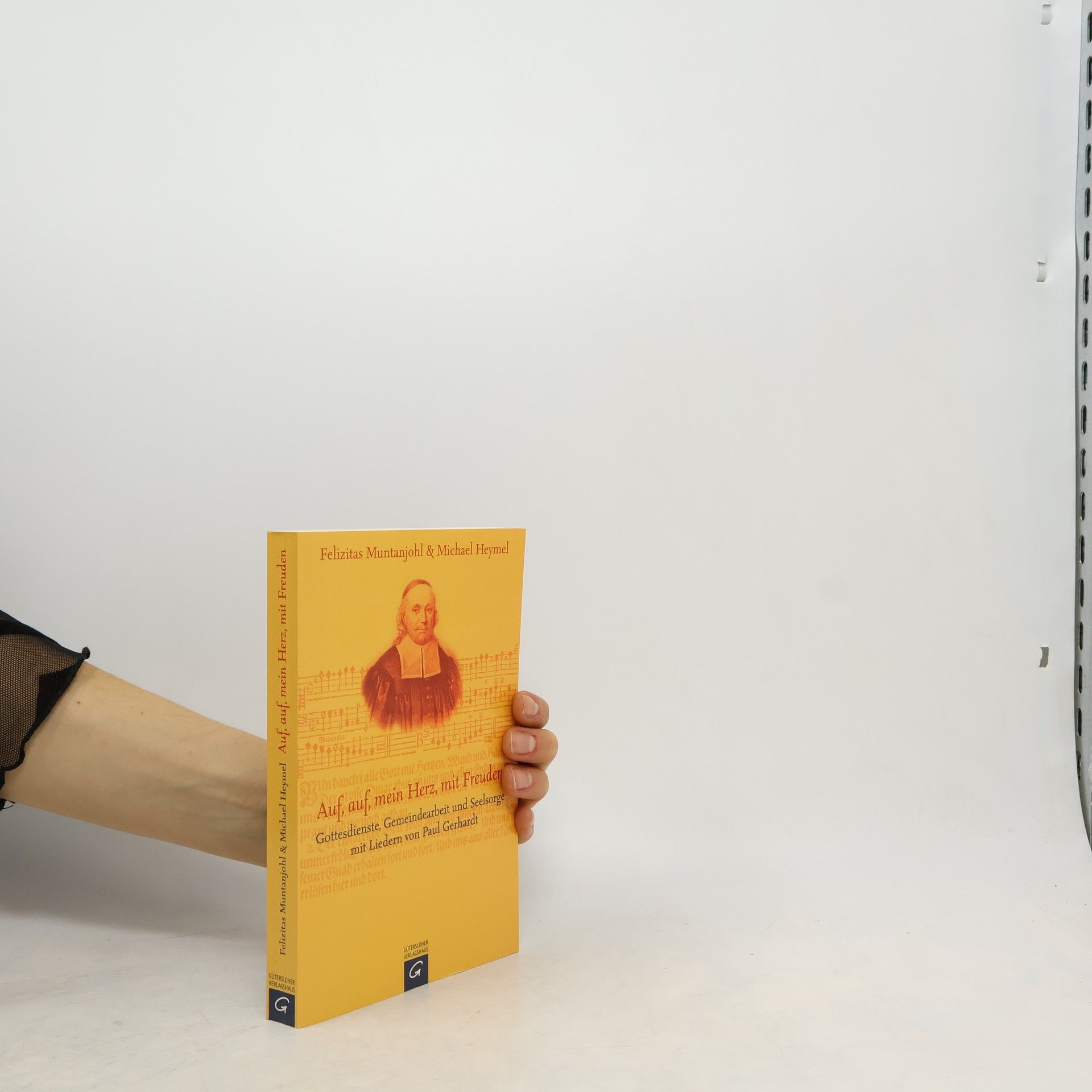
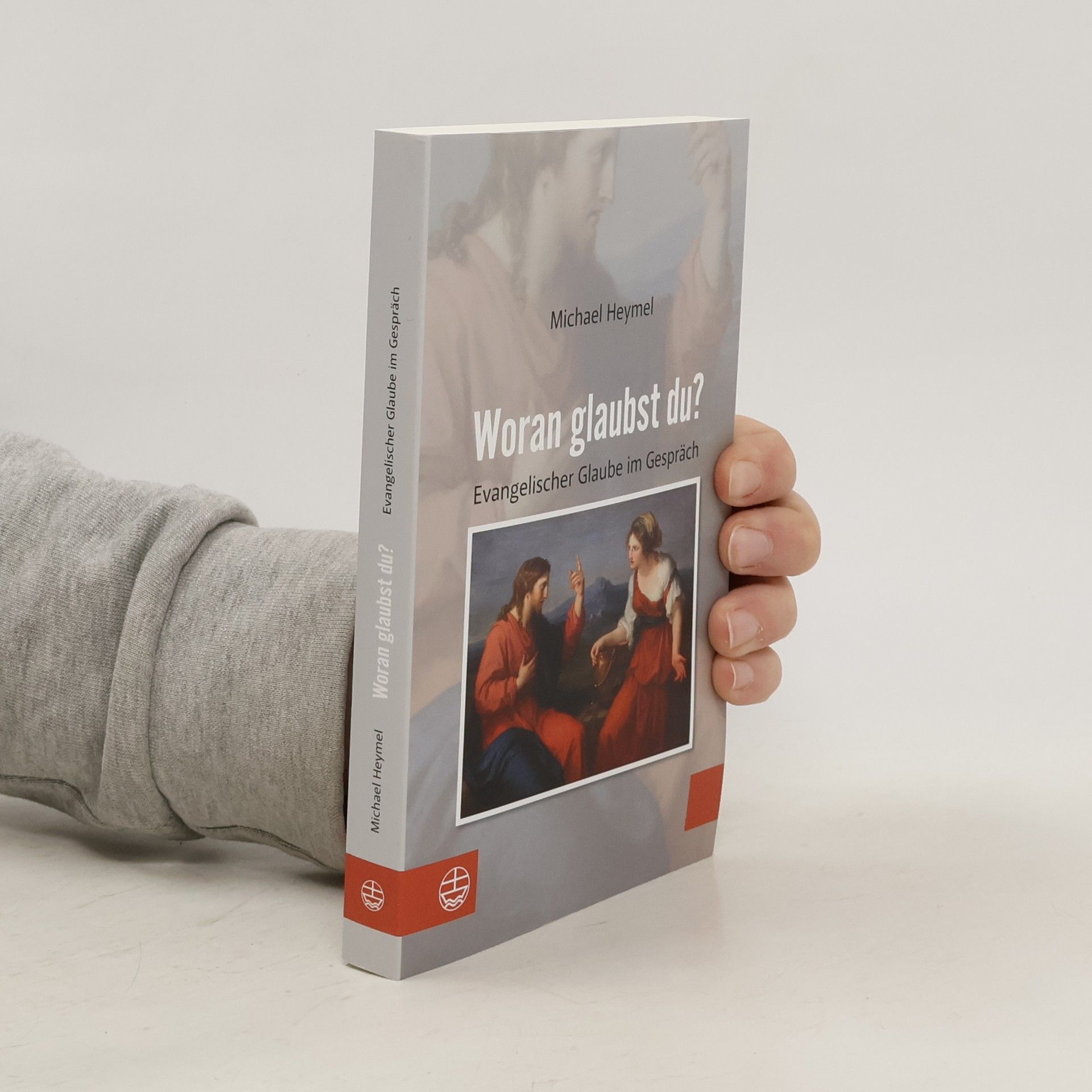


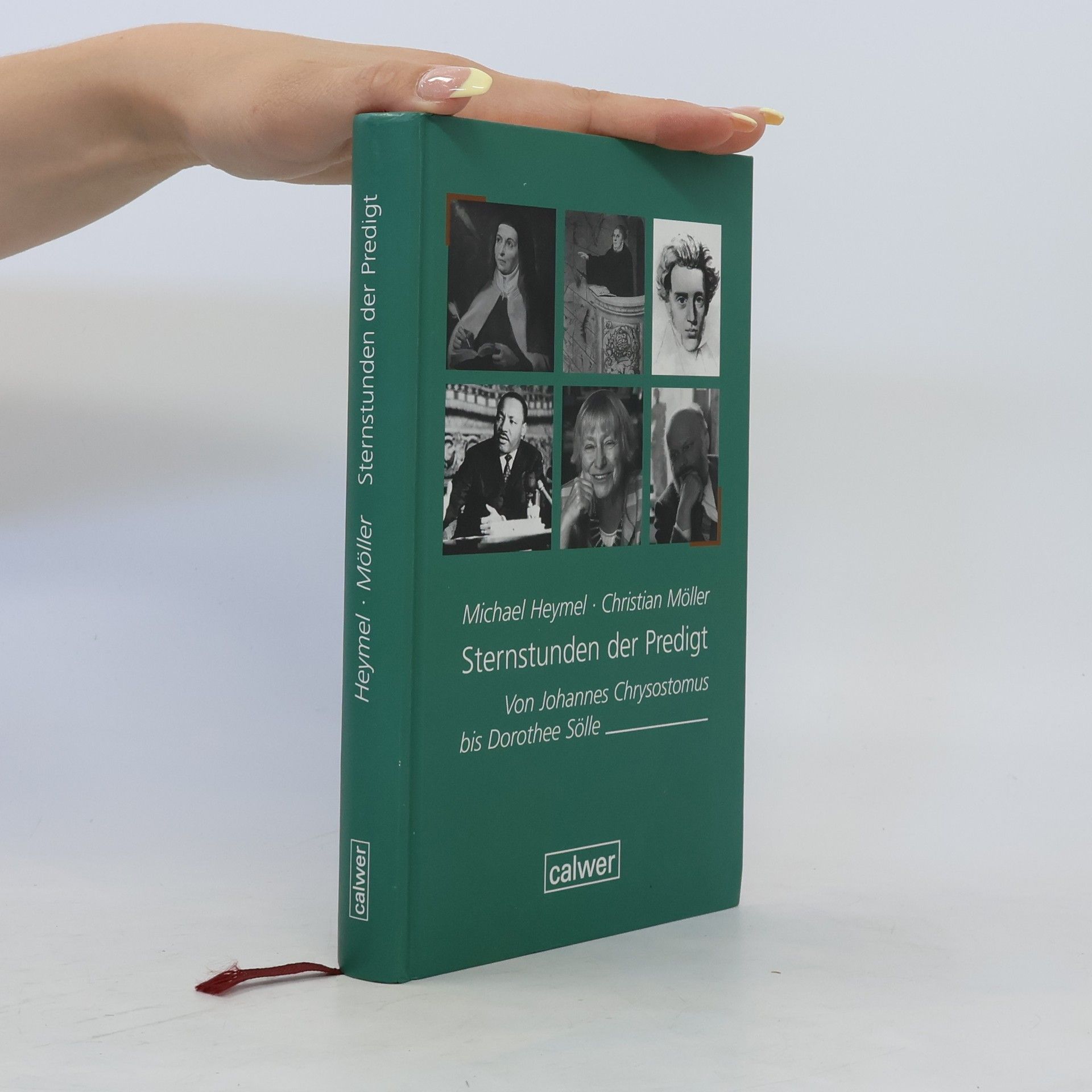
«Im Anfang war das Wort.» Mit diesem bekannten Satz beginnt Johannes sein Evangelium. Viele weitere eingängige Verse folgen: «Ich bin das Licht der Welt» oder «Ich und der Vater sind eins». Über die Jahrhunderte hat das Johannesevangelium seine Leserinnen und Leser zugleich fasziniert und provoziert. Sind diese Verse tiefgründig oder anmassend? Worin unterscheidet das Johannesevangelium sich von den anderen Evangelien? Wie ist ein Evangelium zu deuten, in dem Jesus nicht mit einem Schrei der Gottverlassenheit stirbt, sondern mit der feierlich-gewissen Bekräftigung «Es ist vollbracht»? Michael Heymel zeigt die Worte, Szenen und Bilder des Johannesevangeliums als literarisches Drama. Er behandelt Beispiele für die Rezeption des Evangeliums in Kunst und Musik, zeichnet Stationen seiner Wirkung in der Kirchengeschichte nach und setzt sich mit dem umstrittenen Verhältnis des Evangeliums zum Judentum auseinander. Mit diesem breiten Horizont und seiner zugänglichen Sprache ist das Buch eine Lesehilfe im besten Sinn – geeignet für Einsteigerinnen und Einsteiger, aber auch für fortgeschrittene Bibelleserinnen und Bibelleser, die sich vom Johannesevangelium faszinieren und provozieren lassen wollen.
Sternstunden der Predigt
- 311 Seiten
- 11 Lesestunden
Auf, auf, mein Herz, mit Freuden
- 272 Seiten
- 10 Lesestunden
Mit diesem Grundlagenwerk liegt erstmalig umfassendes Material zu allen Liedern von Paul Gerhard vor, die im Evangelischen Gesangbuch abgedruckt sind. Es enthält Informationen zu Leben und Werk des berühmten Lieddichters und erschließt alle Lieder für die Umsetzung im Gottesdienst: Modelle, Liedpredigten, Meditationen, Andachten, Trostworte und vieles mehr. Ein reicher Materialschatz für die Gemeindearbeit, eine spannende Lektüre für alle, die sich für Paul Gerhardt und seine Lieder interessieren.