Schul-Sachen
Gegenstände von gestern und heute aus dem Schulmuseum Bern. Ein Beitrag zur Materialität von Bildung, Schule und Unterricht
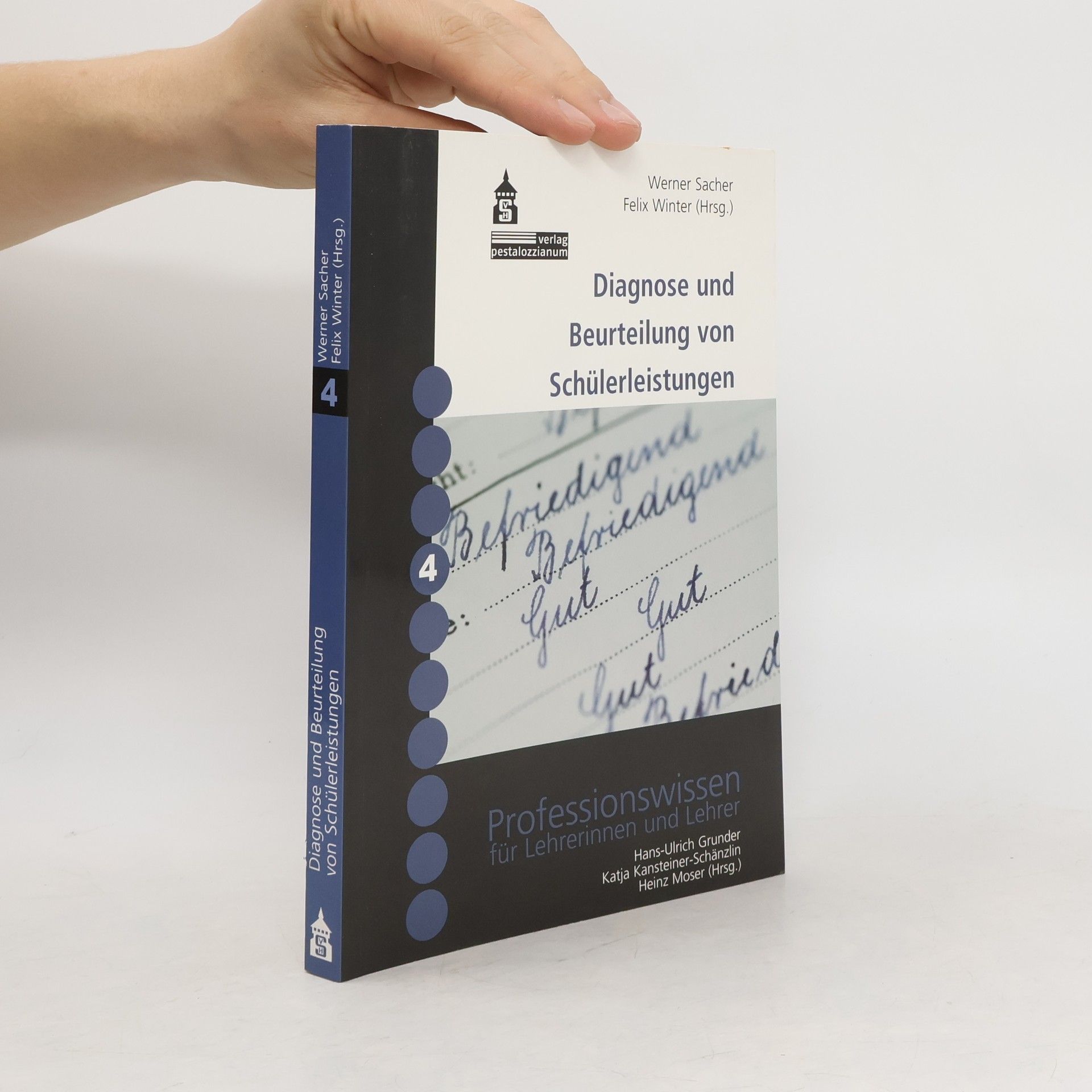
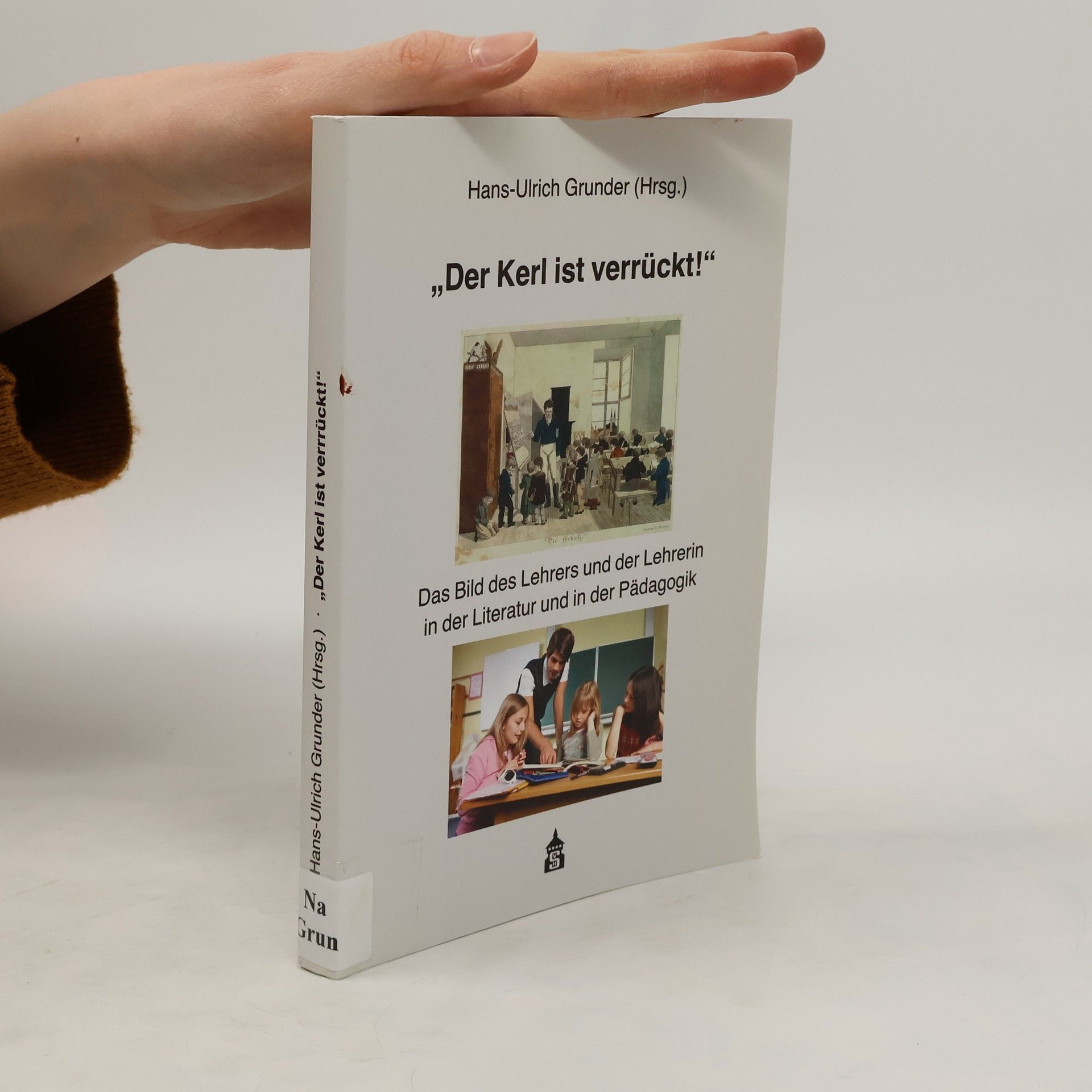

Gegenstände von gestern und heute aus dem Schulmuseum Bern. Ein Beitrag zur Materialität von Bildung, Schule und Unterricht
Grundlagen und Reformansätze