Die Corona-Krise hat unsere Art zu leben ins Wanken gebracht. Dies geschieht keineswegs zum ersten Mal – und wird sich sicher wiederholen. Die Ärzte und Medizinhistoriker Heiner Fangerau und Alfons Labisch erörtern Pandemien samt Covid-19 in ihren historischen, aktuellen und künftigen Dimensionen und diskutieren die Fragen: Hat die Welt so etwas wie die aktuelle Pandemie schon einmal erlebt? Wie veränderten Seuchen das öffentliche und private Leben? Was sind die natürlichen, die sozialen, historischen und kulturellen Hintergründe von Pandemien? Worauf müssen wir uns künftig persönlich und worauf müssen sich Gesellschaft und Gesundheitswesen einrichten, wenn wir unsere Lebensart bewahren wollen?
Heiner Fangerau Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
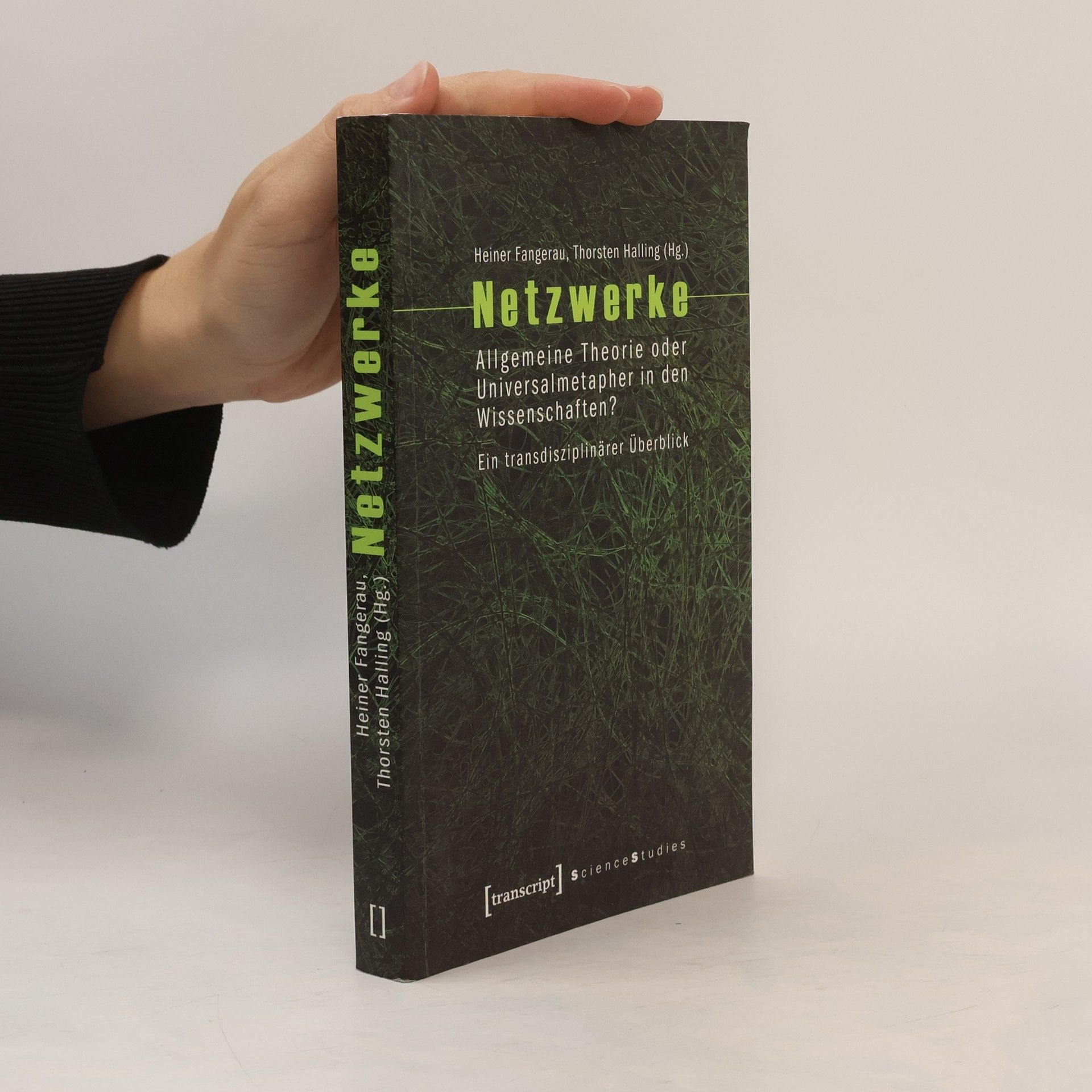
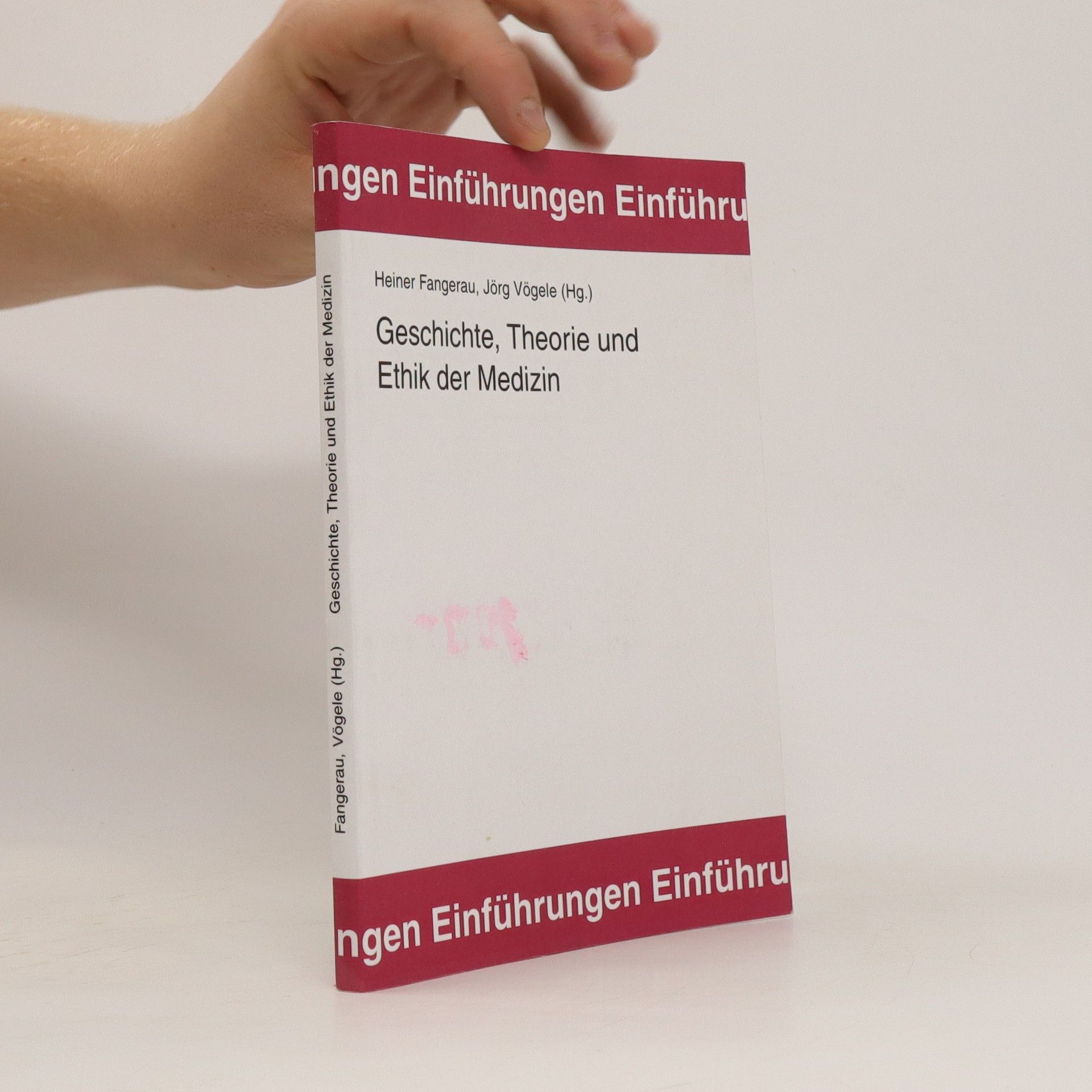

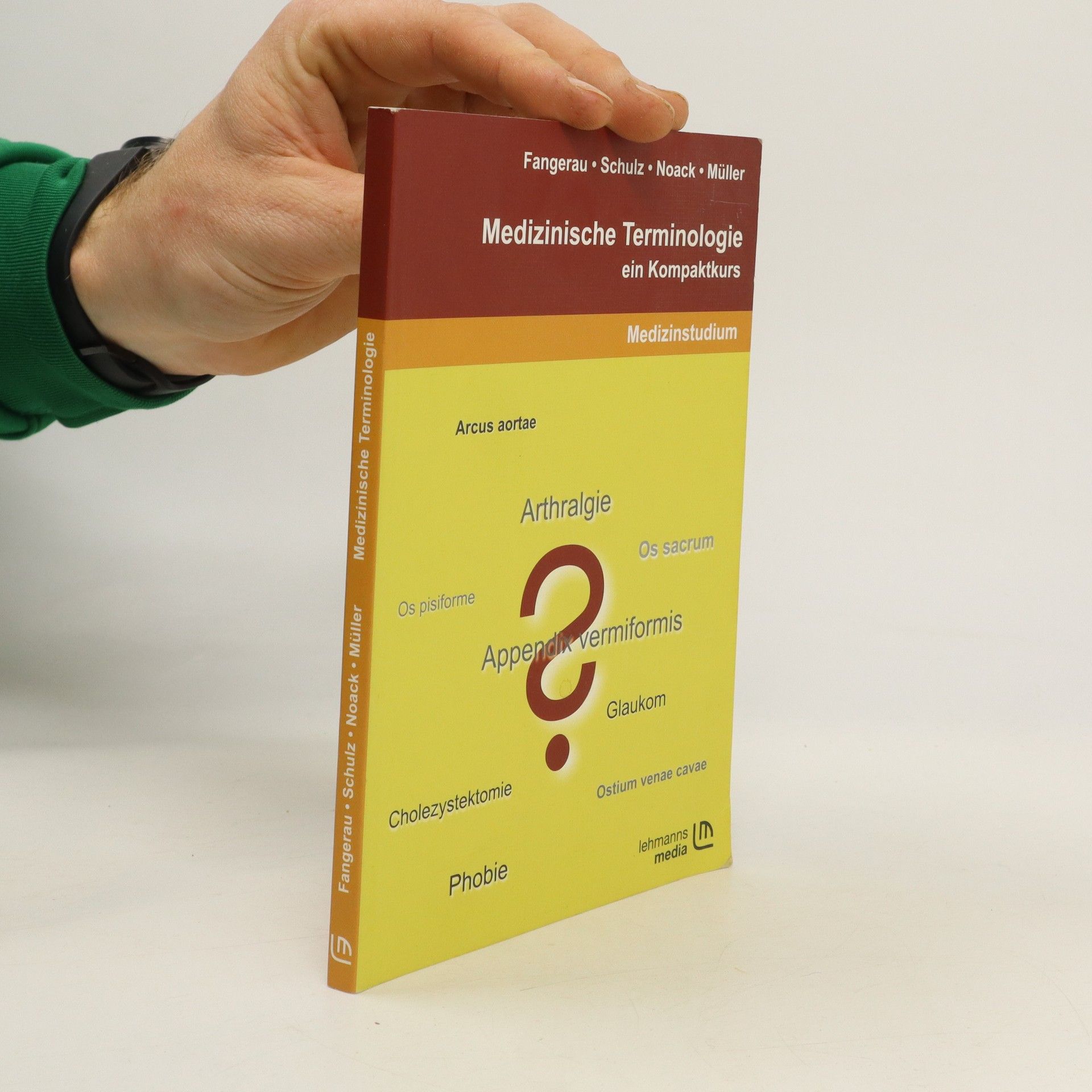
Netzwerke
Allgemeine Theorie oder Universalmetapher in den Wissenschaften? Ein transdisziplinärer Überblick
- 292 Seiten
- 11 Lesestunden
A., Anamnese, Anästhesie … was heißt das? Die Kenntnis der medizinischen Fachsprache gehört zu den Grundfähigkeiten jedes Studierenden der Human-, Tier- und Zahnmedizin. Das Skript "Medizinische Terminologie - ein Kompaktkurs" ist den besonderen Bedürfnissen von Medizinstudierenden, die sich das erste Mal mit Medizinischer Terminologie auseinandersetzen, angepasst. Es soll den Unterricht begleiten und die intensive Arbeit im Kursus Medizinische Terminologie durch Übungen strukturieren. In sechs Lektionen werden Ihnen die wichtigsten Grundregeln und Begriffe der Medizinischen Terminologie anschaulich vermittelt. Zahlreiche Merkhilfen und Beispiele erleichtern Ihnen dabei das Lernen des "Grundwortschatzes" der Fachsprache.