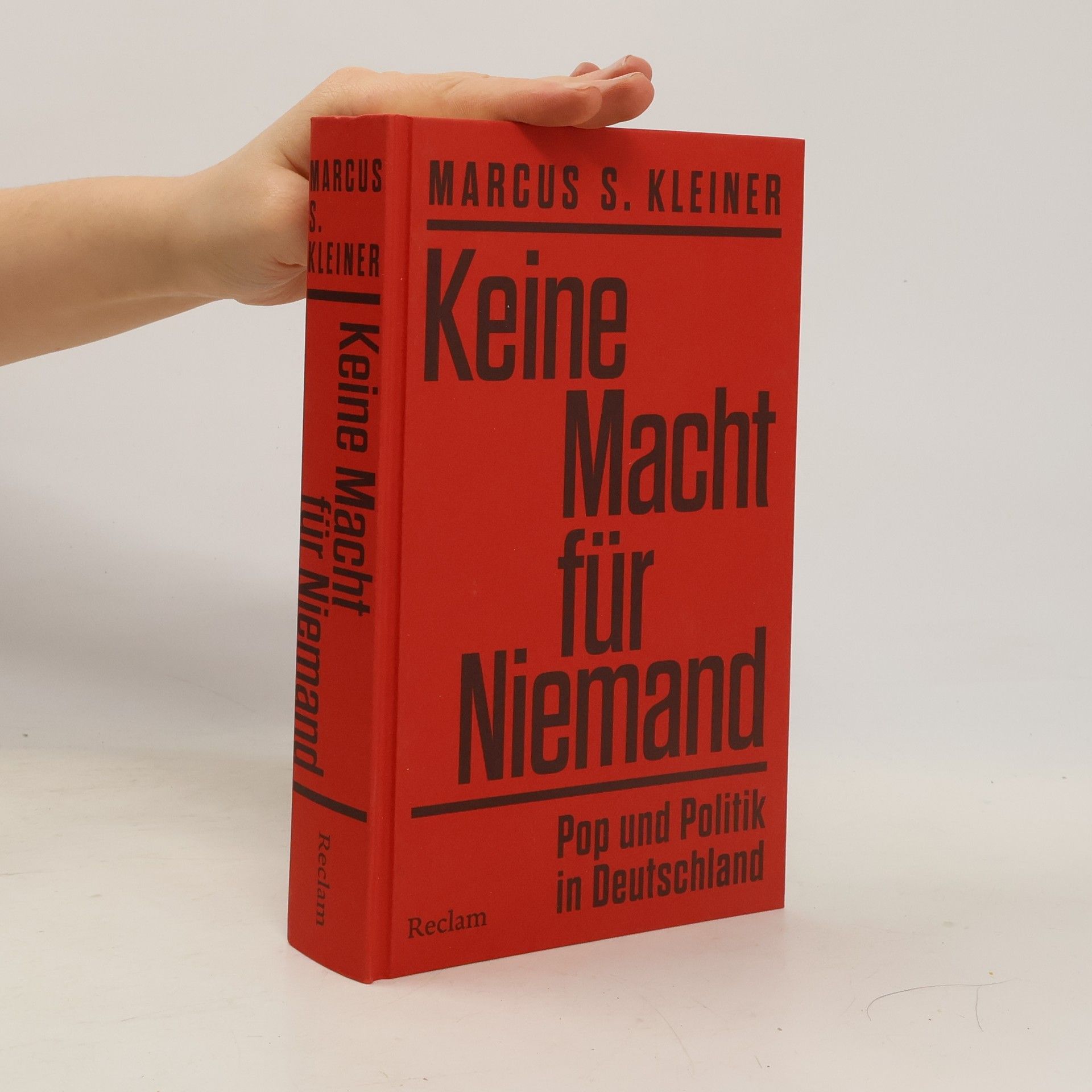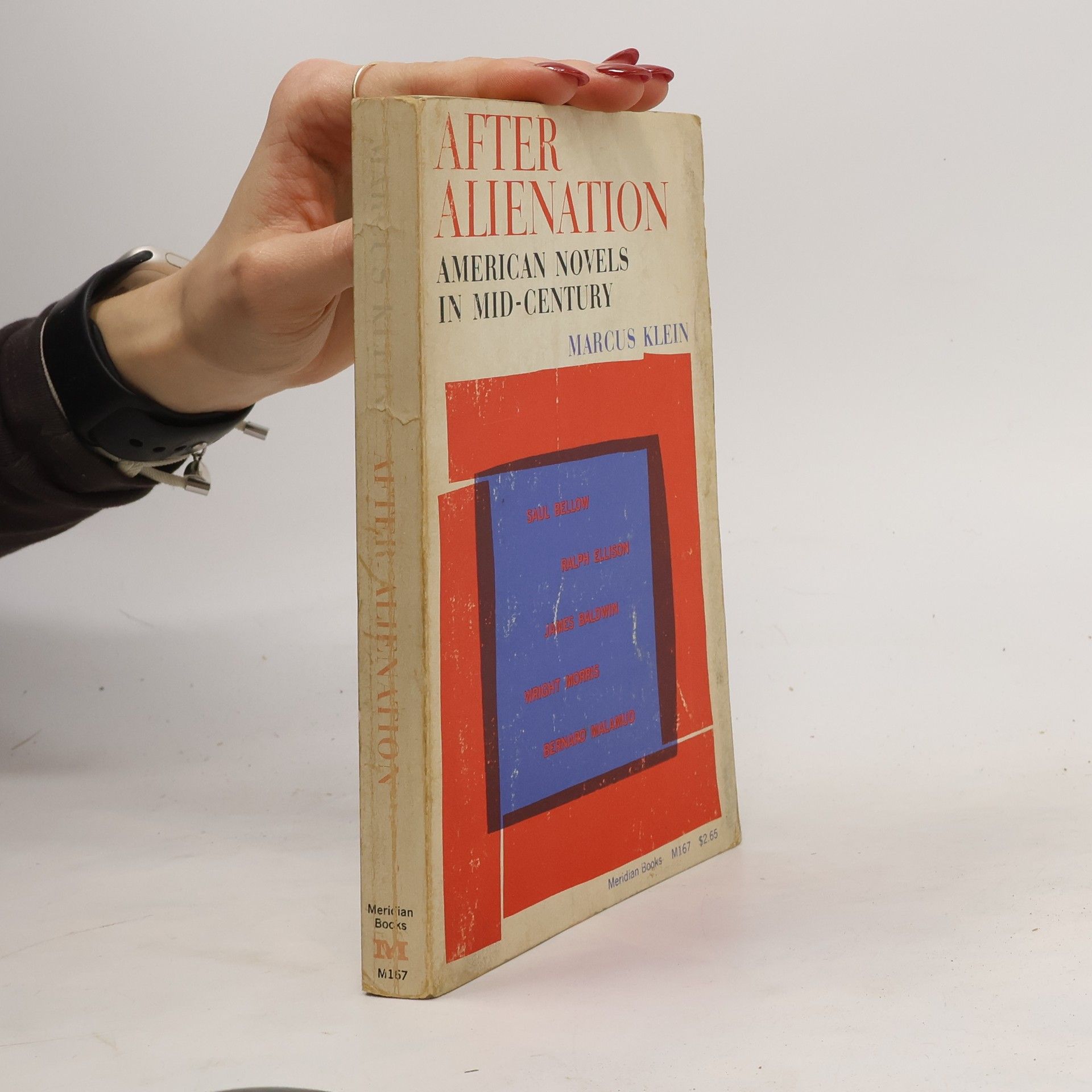Keine Macht für Niemand. Pop und Politik in Deutschland
Popmusik als Spiegel der Gesellschaft – Zeitgeschichte, Protestkultur und Popmusik
- 400 Seiten
- 14 Lesestunden
Was erzählt Pop über die deutsche Geschichte? In der Popmusik spiegelt sich die Zeitgeschichte. Pop leistet dadurch einen Beitrag zur deutschen Erinnerungskultur und wird zum Kritiker der Zustände. Marcus S. Kleiner erzählt die Geschichte der deutschsprachigen Popmusik der letzten 80 Jahre zusammenhängend und beleuchtet das Zusammenspiel von Pop und Politik. Die politische Popmusik bleibt über alle Jahrzehnte hinweg eine Stimme gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, rechte Bedrohungsallianzen, Nationalismus, Militarismus und vieles mehr. Mit zahlreichen Interviews, u. a. mit Sammy Amara (Broilers), Kersty und Sandra Grether (The Doctorella), Thorsten Nagelschmidt (Muff Potter), Ingo Donot, Jan Müller (Tocotronic) und Nikel Pallat (Ton Steine Scherben). »Das Phänomen Popmusik an sich finde ich politisch. Weil es mit der Gesellschaft zu tun hat, weil Popmusik in der Gesellschaft funktioniert und dort sofort politische Fragen aufwirft.« Thorsten Nagelschmidt (Muff Potter)