Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis 1923
- 499 Seiten
- 18 Lesestunden
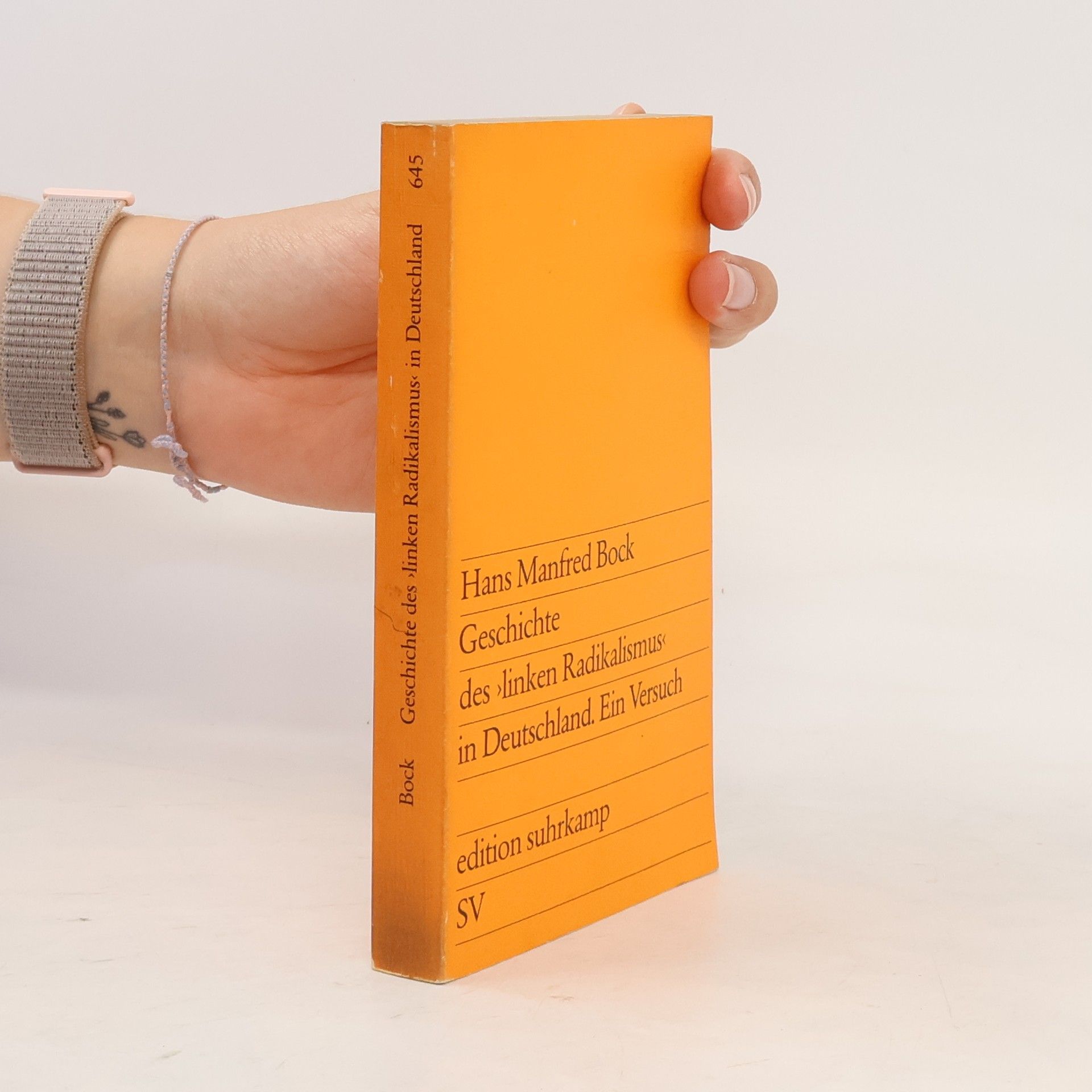
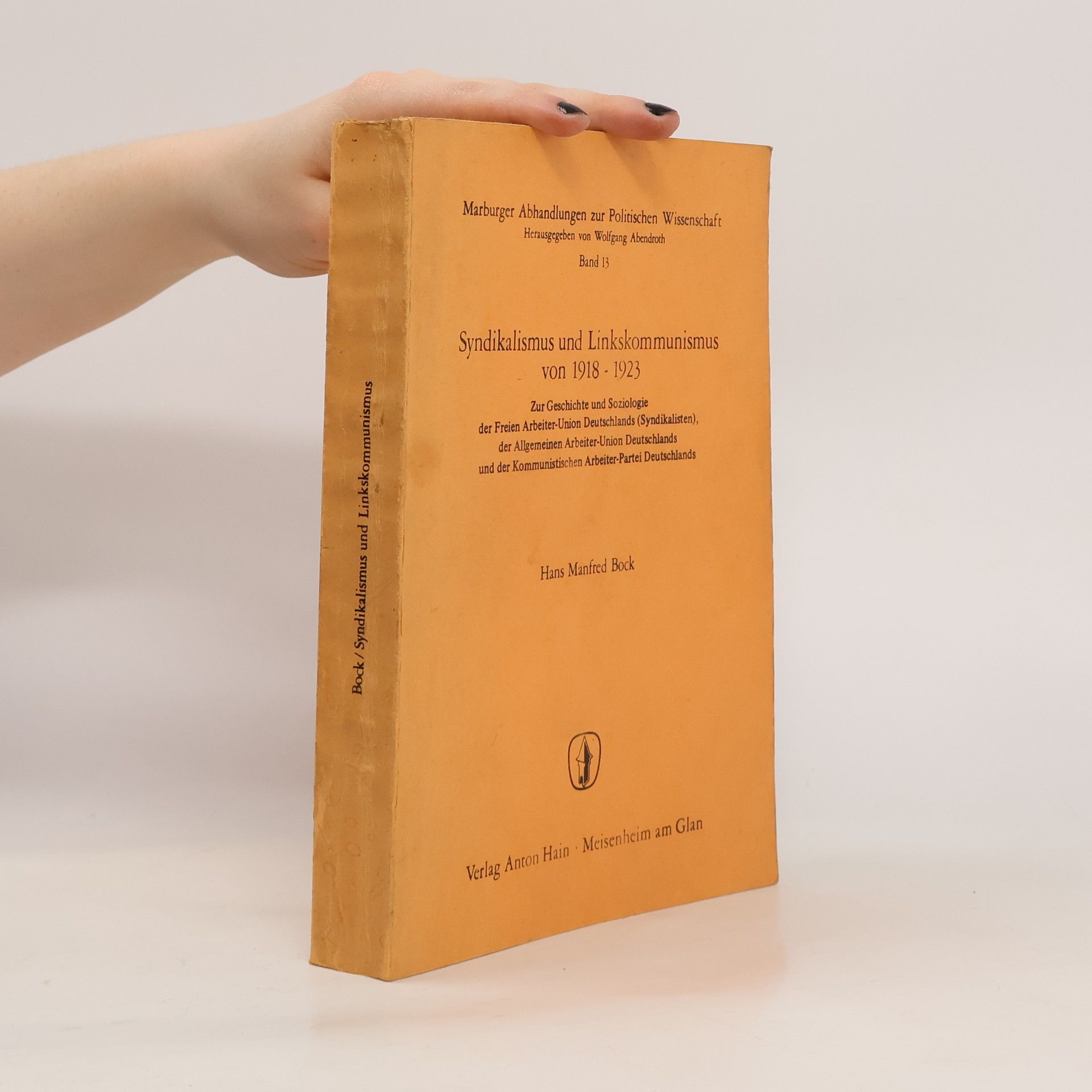
Nicht erst seit Lenin, der den "linken Radikalismus" als die Kinderkrankheit des Kommunismus bezeichnet hat, ist die Auseinandersetzung zwischen linken und rechten Fraktionen ein Bestandteil der Arbeiterbewegung und der Geschichte sowohl ihrer Theoriebildung als auch ihrer politischen Praxis gewesen. Eine spezifizierende Darstellung dieser "linken Abweichung", eine historisch argumentierende Soziologie des linken Radikalismus, soweit er in Deutschland sich artikuliert hat, gibt der Kasseler Politikwissenschaftler in seinem Buch. Er erschließt ein für das Verständnis politischer Strukturen wesentliches Material - die linksradikalen Ideen in Deutschland von der Revolte der "Jungen" in der SPD um 1890 über die rätekommunistische Bewegung zwischen 1918 und 1933 bis zur Studentenrevolte 1966 bis 1969.