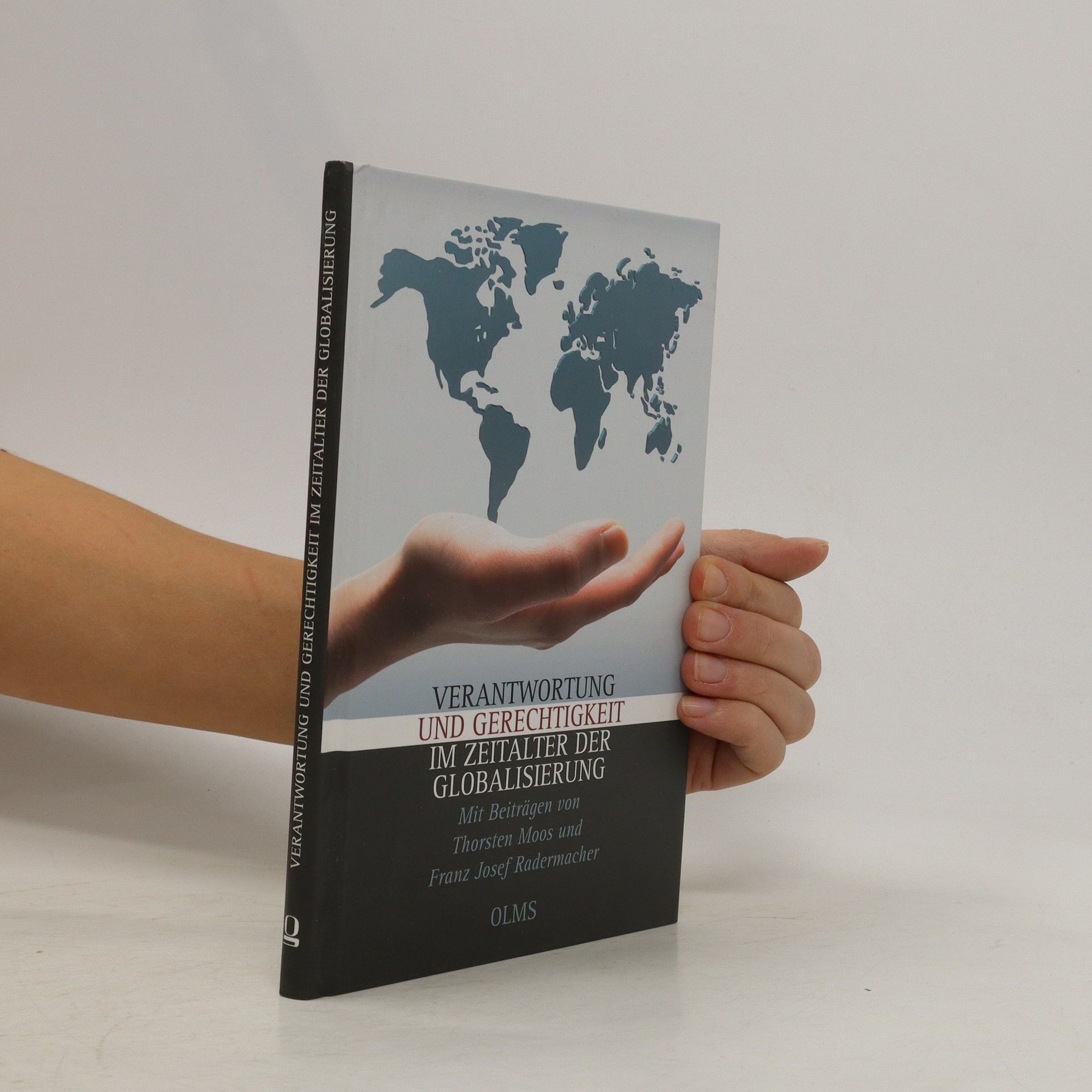Verantwortung und Gerechtigkeit im Zeitalter der Globalisierung
- 88 Seiten
- 4 Lesestunden
Enthält: Thorsten Moos, Klimagerechtigkeit und Weltethos. Theologische Zugänge zur Frage der Zukunft der Menschheit; Franz Josef Radermacher, Globalisierung und Gerechtigkeit – Einige Überlegungen zu einem schwierigen Thema. Die weltweite soziale Ungleichheit ist alarmierend: 20% der Bevölkerung besitzen über 80% des Wohlstands, während täglich etwa 24.000 Menschen an Hunger sterben. Diese Probleme scheinen oft außerhalb unseres Alltags zu liegen. Ein Kongress über Verantwortung und Gerechtigkeit im Prozess der Globalisierung, veranstaltet von der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, zielt darauf ab, das Bewusstsein für diese Themen zu schärfen. Der Band macht die Ergebnisse des Kongresses einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Moos betrachtet die Rolle der Religionen kritisch und betont, dass sie zur Vernunftsgeschichte beitragen und zum Handeln anregen können. Radermacher entwirft ein Konzept für eine ausgewogene Welt, auch in Zeiten der Globalisierung. Er plädiert für Kooperation und eine Handlungsmaxime, die auf gegenseitigem Respekt basiert. Dies erfordert jedoch technische Innovationen und einen Umbau der Zivilisation. Radermacher fordert eine Abkehr von kurzfristigem Denken hin zu einer globalen Ökosozialen Marktwirtschaft. Der Weg zu einer gerechteren Welt ist herausfordernd, aber lohnenswert.