Michaela Kronberger Bücher

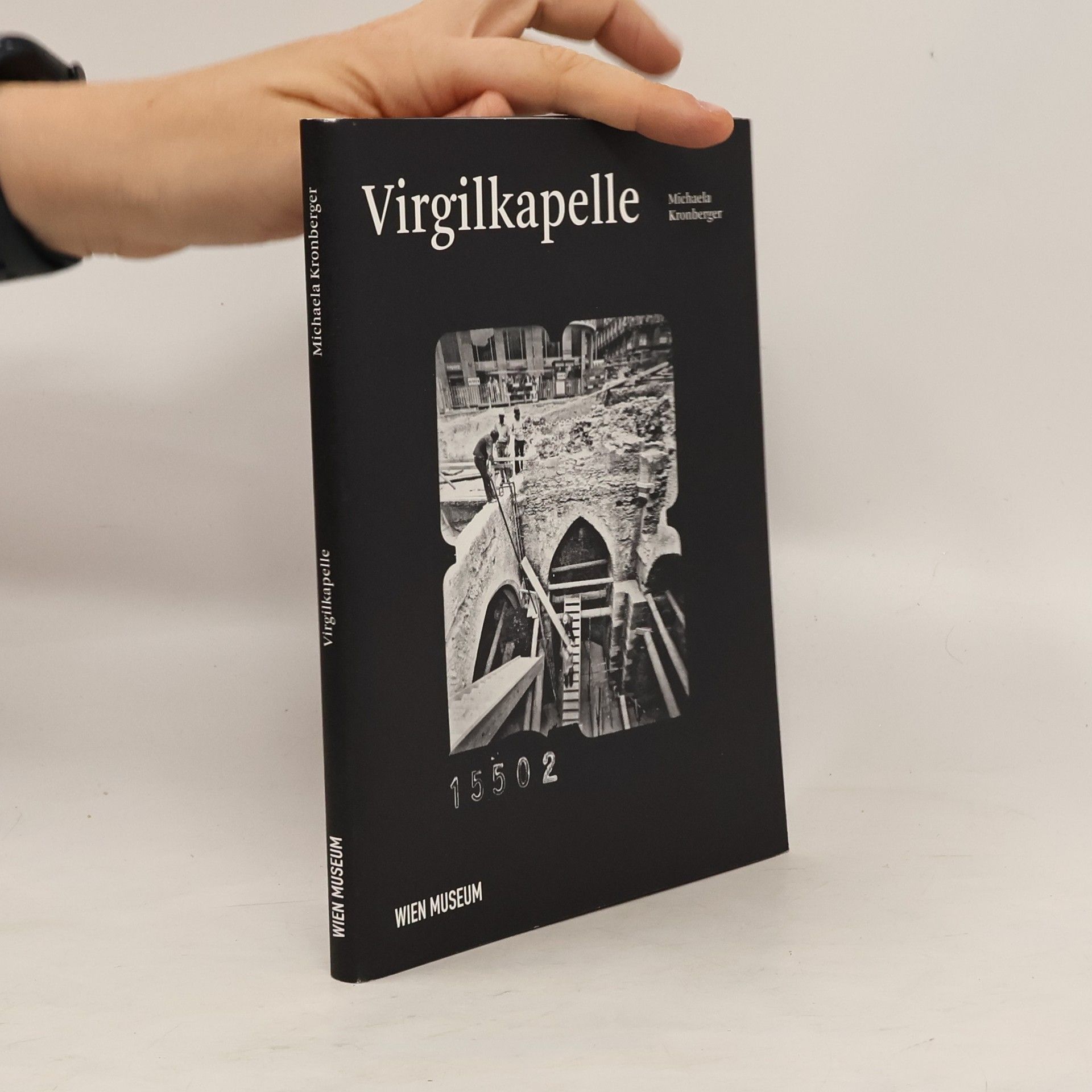
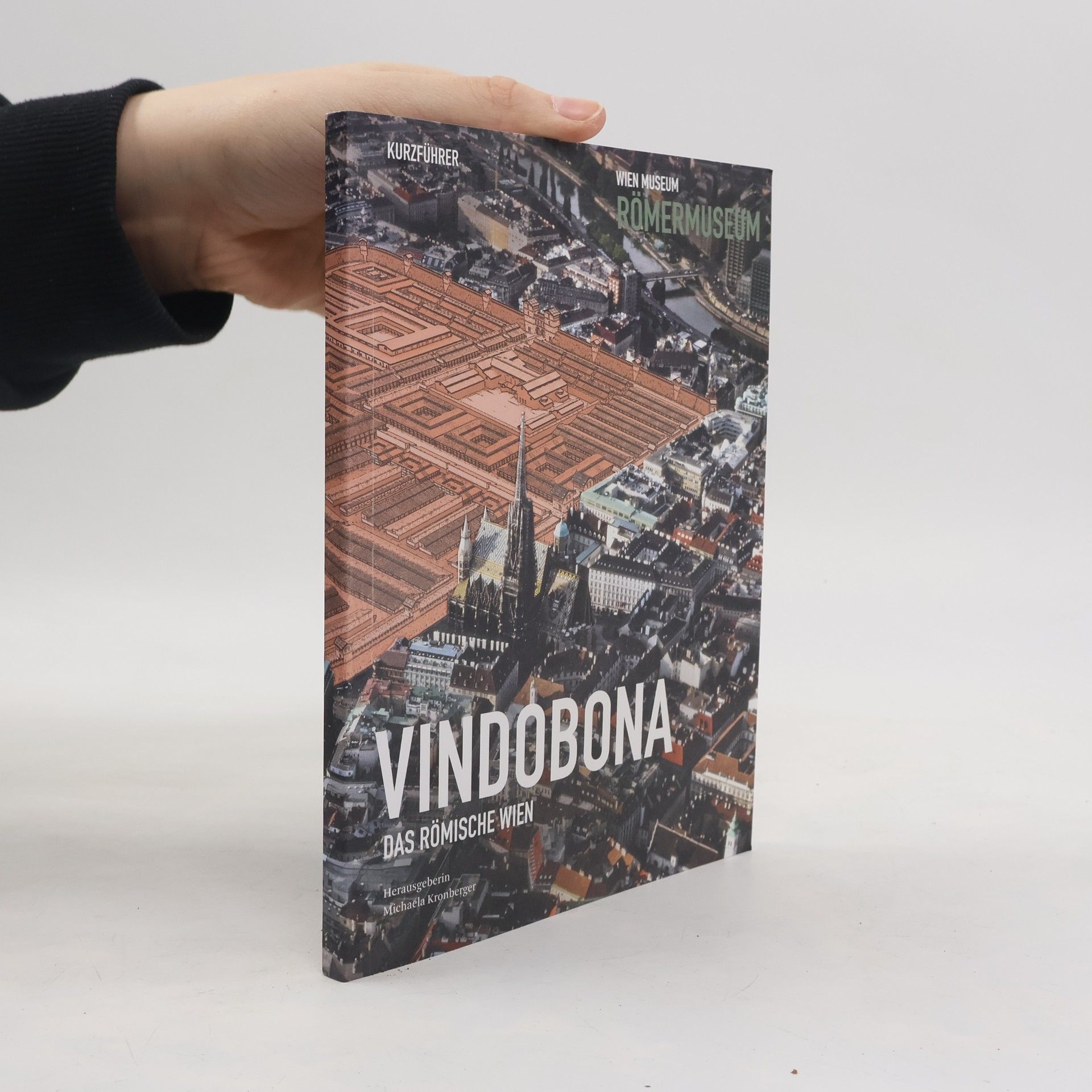
Der Dombau von St. Stephan
- 207 Seiten
- 8 Lesestunden
In Wien sind mit den Architekturzeichnungen von St. Stephan aus dem Spätmittelalter einzigartige Zeugnisse der gotischen Baukunst erhalten: Von keinem gotischen Dombau in Europa hat eine derart große Zahl von Planrissen auf Pergament und Papier, die von den Dombaumeistern gezeichnet wurden, die Jahrhunderte überlebt. Die kostbaren Planzeichnungen, die sich seit 2005 auf der UNESCO-Liste des Weltdokumentenerbes finden, stehen im Zentrum der Ausstellung, die in Kooperation mit dem Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste entstand. Sakralbauten wie die Stephanskirche zählen zu den großen architektonischen Leistungen des Mittelalters. Im Zuge der jahrzehntelangen Bautätigkeit kam es immer wieder zu Umplanungen, die Ausstellung vermittelt die neuesten Erkenntnisse zum Bau von St. Stephan, der viele Fragen aufwirft.