Additive manufacturing (AM) offers significant design freedom, particularly in laser-based powder bed fusion of metals, where support structures are often necessary for printability and process reliability. However, there is insufficient knowledge regarding the design of these support structures, which can lead to build failures and excessive material use. This study aimed to develop a method for designing tree-like support structures to optimize the mechanical performance of AM parts. Experimental investigations were conducted on the printability, geometrical accuracy, and strength of thin struts, complemented by an AM process simulation model for four generic overhang geometries. This model facilitated parameter optimization to identify design parameters, yielding Pareto optimal support designs in terms of support volume and part deformation. Printed sample measurements validated simulation results and the effectiveness of tree-like supports. Additionally, two case studies on the additive manufacturing of discontinued spare parts provided initial validation of the approach. This research uniquely integrated thermal and structural loads in parameter optimization to enhance part mechanical behavior. A successful print on the first attempt demonstrated the approach's potential, laying the groundwork for automated support generation tools that require minimal user input.
Sebastian Weber Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

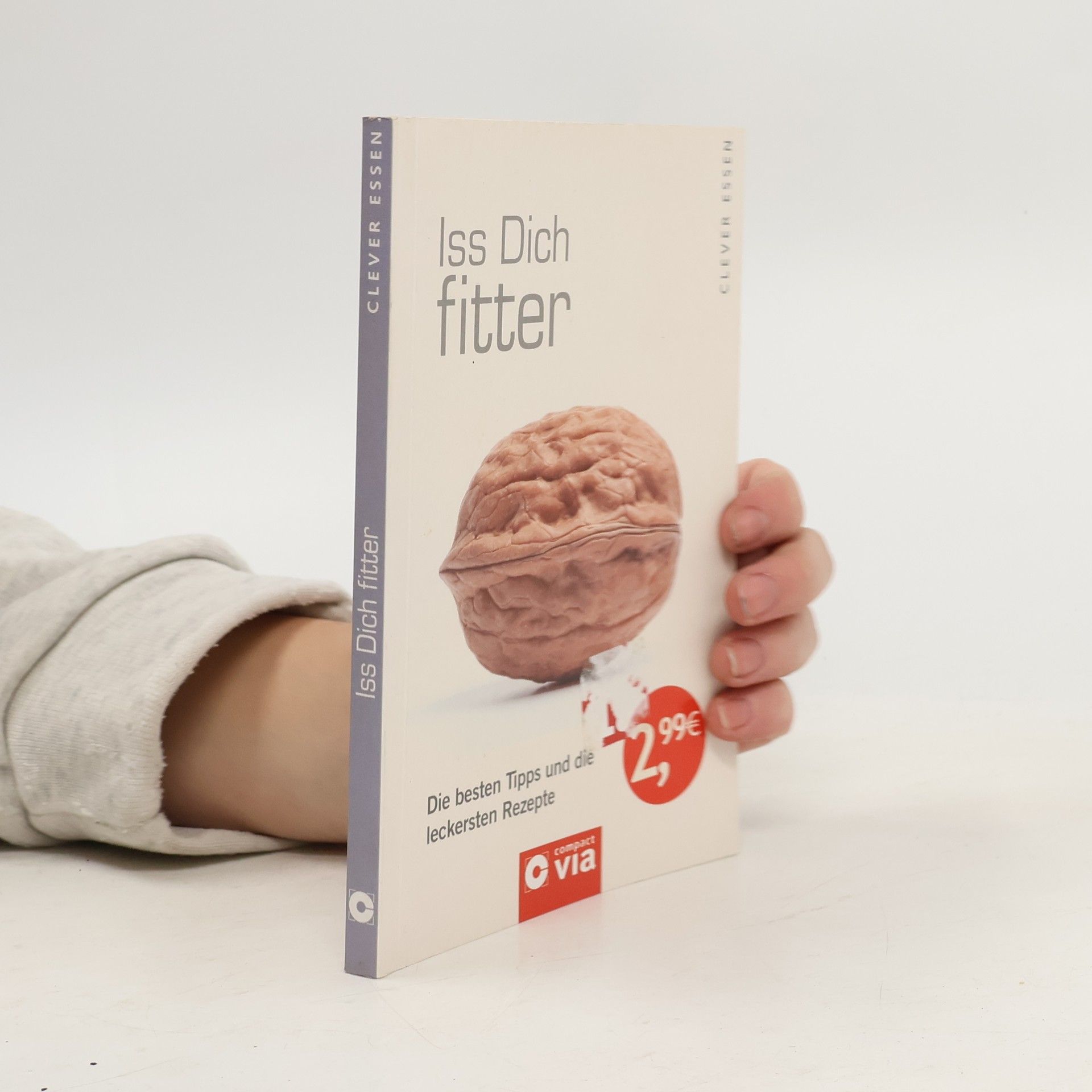




Stuhltänze in der Grundschule
8 Choreografien für Unterricht & Aufführung
In der Klasse fehlt oft der Raum für Bewegung, doch manchmal ist ein Energie-Boost oder mehr Fokussierung gefragt. Mit acht Stuhltänzen zu bekannten Melodien wie „Froh zu sein bedarf es wenig“ oder „Jingle Bells“ bringen Sie gute Laune und Action ins Klassenzimmer – ideal für zwischendurch, als Ritual, im Sitzkreis oder bei Aufführungen. Die bebilderten Beschreibungen und umfangreiches Videomaterial unterstützen Sie dabei. Choreografien müssen nicht raumgreifend sein; mit den Stuhltänzen können alle Kinder an ihrem Platz aktiv mitmachen. Dies spart Zeit und bringt Bewegung in den Musikunterricht, kann aber auch in anderen Fächern für kurze, bewegte Einheiten sorgen, nach denen die Schüler fokussierter arbeiten können. In diesem Unterrichtsmaterial erfahren Sie, wie Sie acht einfache Tanz-Choreografien zu beliebten Liedern einstudieren. Zu jeder Choreografie erhalten Sie ein passendes Warm-up, ein Video-Tutorial, den kompletten Ablauf zum Weitergeben an die Schüler, kurze Übersichten als Erinnerungsstütze, Hintergrundinformationen sowie Differenzierungsmöglichkeiten und alternative Bewegungsideen.
Das Werk widmet sich einem Kernereignis innerhalb der schweizerischen Kodifikationsgeschichte. Es behandelt die Revision des Obligationenrechts von 1881/1883 und arbeitet in diesem Zusammenhang systematisch dessen Entstehungsgeschichte auf. Auf Basis unveröffentlichter Materialien aus dem schweizerischen Bundesarchiv, die der Verfasser historisierte sowie retrospektiv bewertete, werden nicht nur die Gesetzgebungschronologie dargestellt, sondern auch im Einzelnen die Motive der Gesetzgebungsprotagonisten bei der Fassung zentraler Normbereiche analysiert. Diejenigen Rechtsinstitute, die die Revision entscheidend charakterisierten, greift die Arbeit anschließend nochmals gesondert auf und thematisiert deren Stellung im gesamteuropäischen Rechtssystem insbesondere mit Blick auf das Deutsche BGB, das die Reformarbeiten stetig begleitete. Resümierend stellt der Autor fest, inwieweit durch die Revision des Obligationenrechts ein Fortschritt erreicht werden konnte.
Arbeitszeit und Dienstplanung
in Einrichtungen der Caritas
Das Buch 'Iss Dich fitter' aus der Reihe 'Clever essen' zeigt, dass bewusste Ernährung Spaß macht und lecker sein kann. So werden Sie beweglicher, aktiver und haben mehr Energie für Alltag und Freizeit. Auf Genuss muss nicht verzichtet werden, denn der umfassende Rezeptteil bietet abwechslungsreiche Gerichte für jede Gelegenheit. Zu jedem Rezept gibt es den Clever-essen-Effekt, der die unmittelbaren Auswirkungen der jeweiligen Zutatenkombination auf den Körper aufzeigt (z. B. Muskelaufbau, Stärkung der Gelenke). Der Ratgeberteil umfasst alles zu Wirkstoffen, Lebensmitteln und Zubereitungsarten und man erfährt, wie effektiv bewusste Ernährung sein kann. - Kochbuch & Ratgeber für mehr Energie - gesunde, aber dennoch genussvolle Ernährung - Grundlagenteil mit allem Wissenswerten zu Lebensmitteln, Effekt auf den Körper - Rezeptteil mit Gerichten, die sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken - mit Clever-essen-Effekt zu jedem Rezept
Das Buch 'Iss Dich jünger' aus der Reihe 'Clever essen' zeigt, dass bewusste Ernährung Spaß macht und lecker sein kann. Durch die richtigen Zutaten werden die Zellen gestärkt und der Organismus positiv beeinflusst. So gewinnt man mühelos neue Energie, fühlt sich jünger und strahlt Frische aus. Auf Genuss muss nicht verzichtet werden, denn der umfassende Rezeptteil bietet abwechslungsreiche Gerichte für jede Gelegenheit. Zu jedem Rezept gibt es den Clever-essen-Effekt, der die unmittelbaren Auswirkungen der jeweiligen Zutatenkombination auf den Körper aufzeigt (z. B. elastische Haut, Stärkung der Knochen). Der Ratgeberteil umfasst alles zu Wirkstoffen, Lebensmitteln und Zubereitungsarten und man erfährt, wie effektiv bewusste Ernährung sein kann. - Kochbuch & Ratgeber für mehr jugendliche Ausstrahlung - gesunde, aber dennoch genussvolle Ernährung - Grundlagenteil mit allem Wissenswerten zu Lebensmitteln, Effekt auf den Körper - Rezeptteil mit Gerichten, die sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken - mit Clever-essen-Effekt zu jedem Rezept