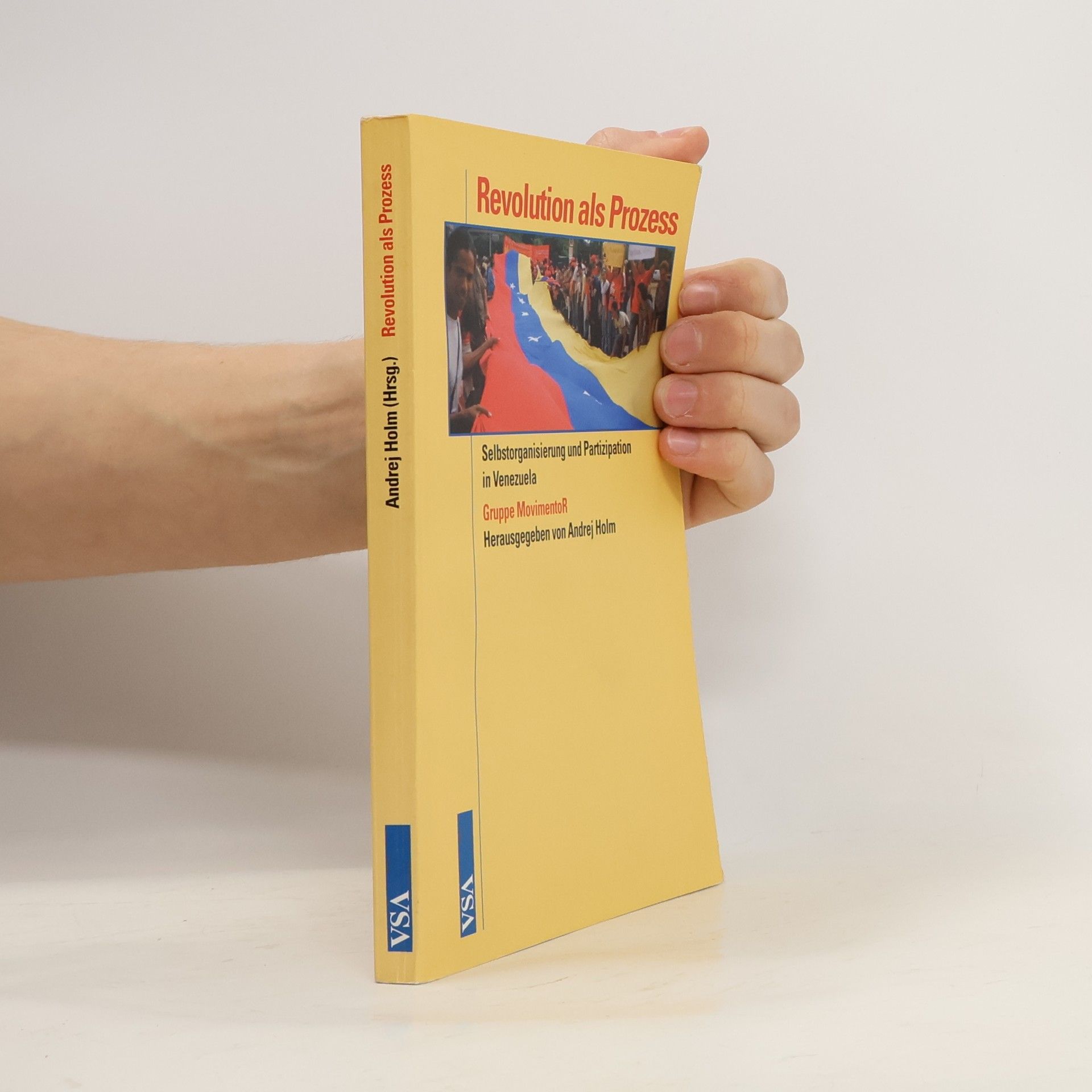Gentrification, die Inwertsetzung bisher preiswerter Wohnviertel, hat sich zu einem ständigen Begleiter städtischer Veränderungen entwickelt und steht für die neoliberale Version kapitalistischer Urbanisierung. Sanierte Häuser und neue Gewerbenutzungen stehen nicht nur für einen Wandel der Stadt, sondern vor allem für steigende Wohnkosten, die Verdrängung ökonomisch Benachteiligter und die Durchsetzung neuer Sozialstrukturen in den betroffenen Quartieren. Weltweit lösen diese immobilienwirtschaftlichen Aufwertungsstrategien Proteste und Widerstand der bisherigen BewohnerInnen aus. 'Wir Bleiben Alle!' Das Recht zu Bleiben, ist dabei eine zentrale Forderung vieler Stadtteilinitiativen. An internationalen Beispielen werden die Hintergründe und Wirkungsweisen städtischer Aufwertungsdynamiken ebenso nachgezeichnet, wie die Strategien von Stadtteilbewegungen und Anti-Gentrification Mobilisierungen.
Andrej Holm Bücher
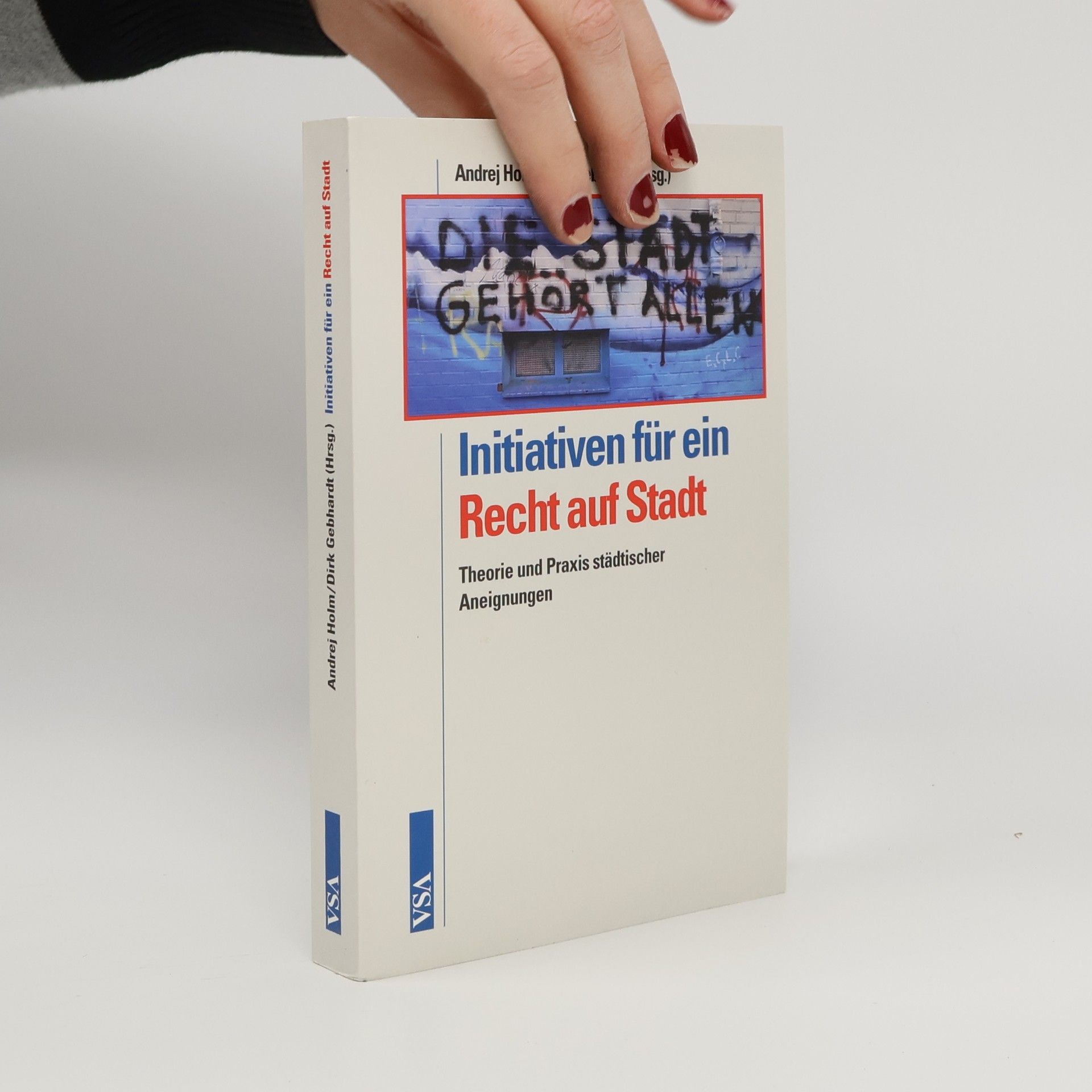
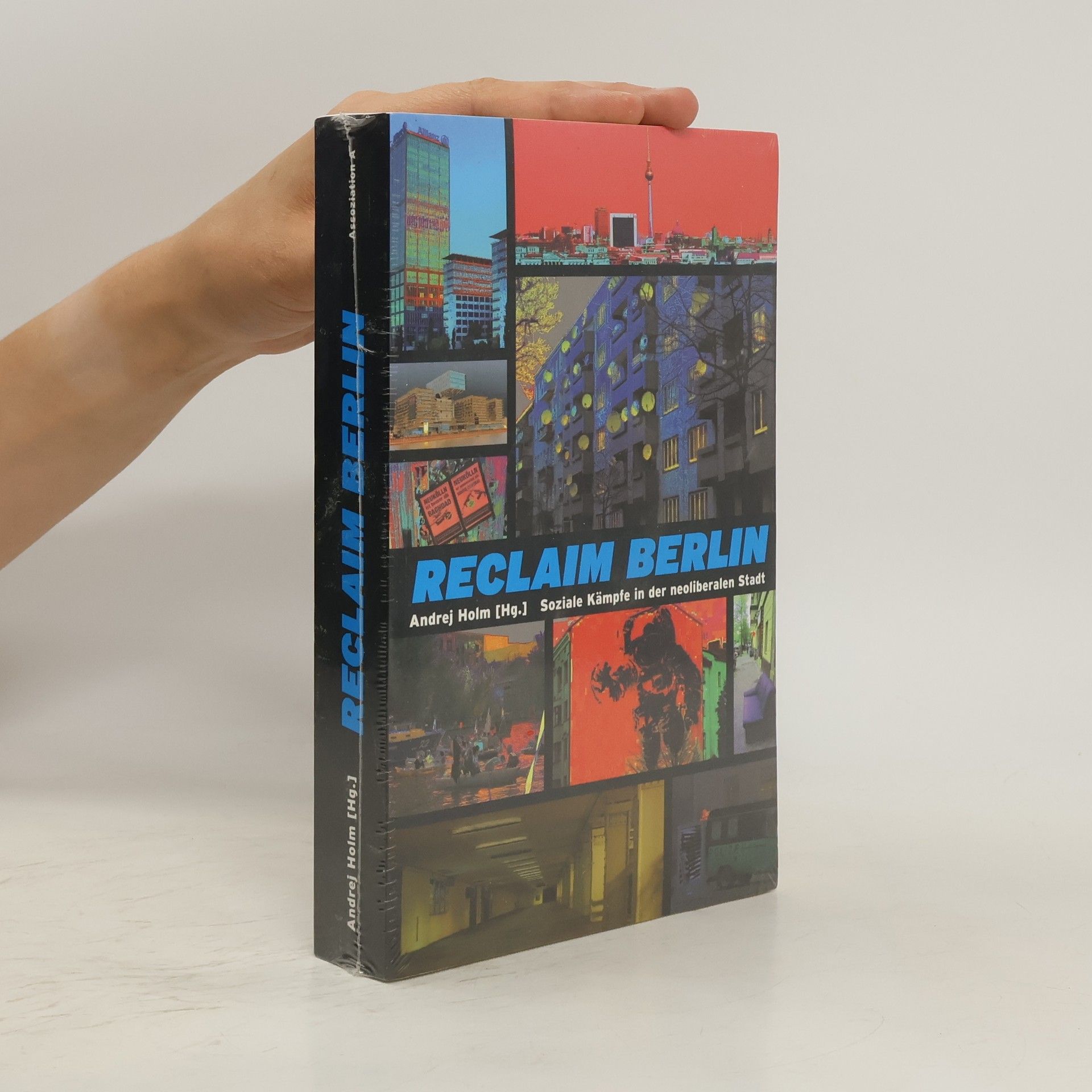
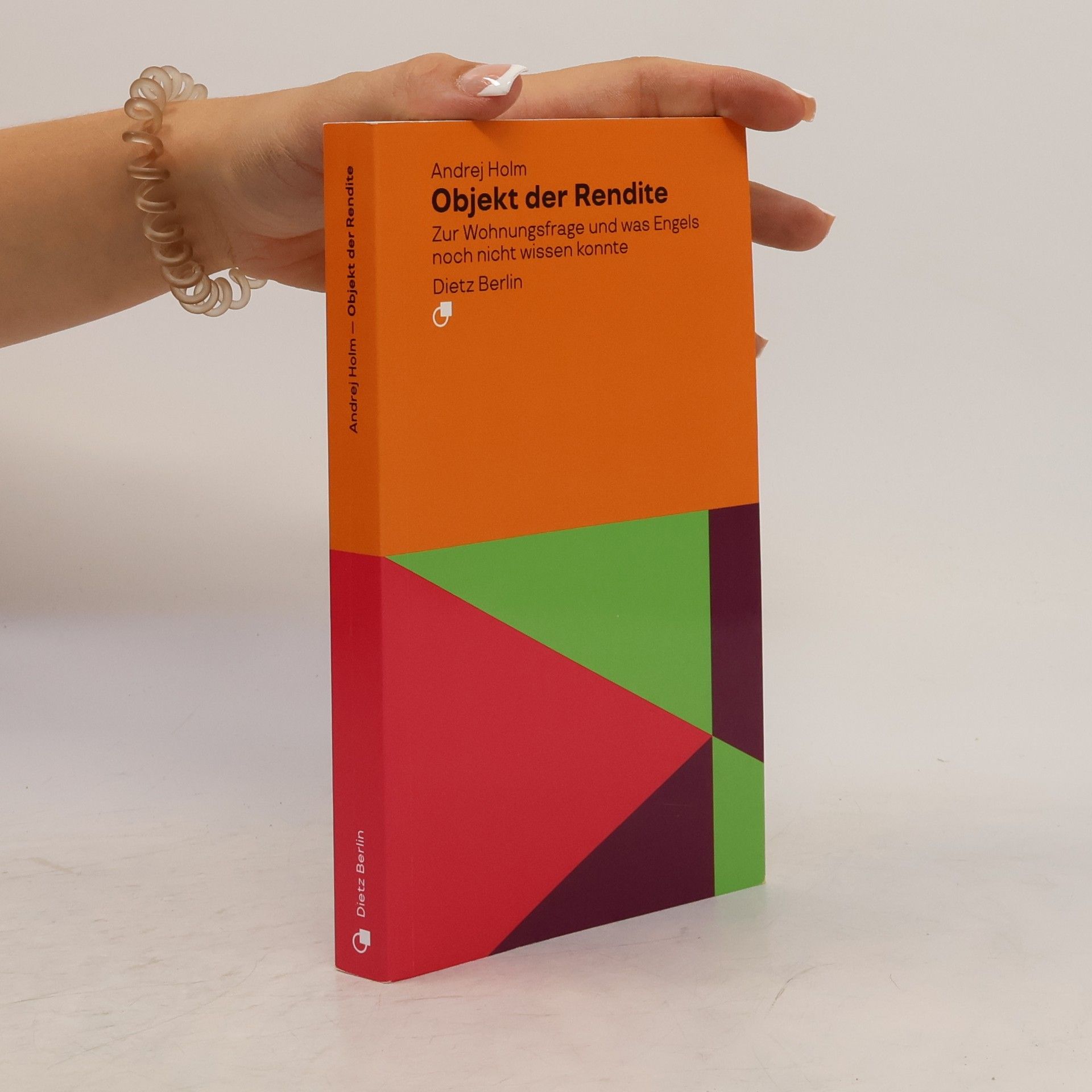
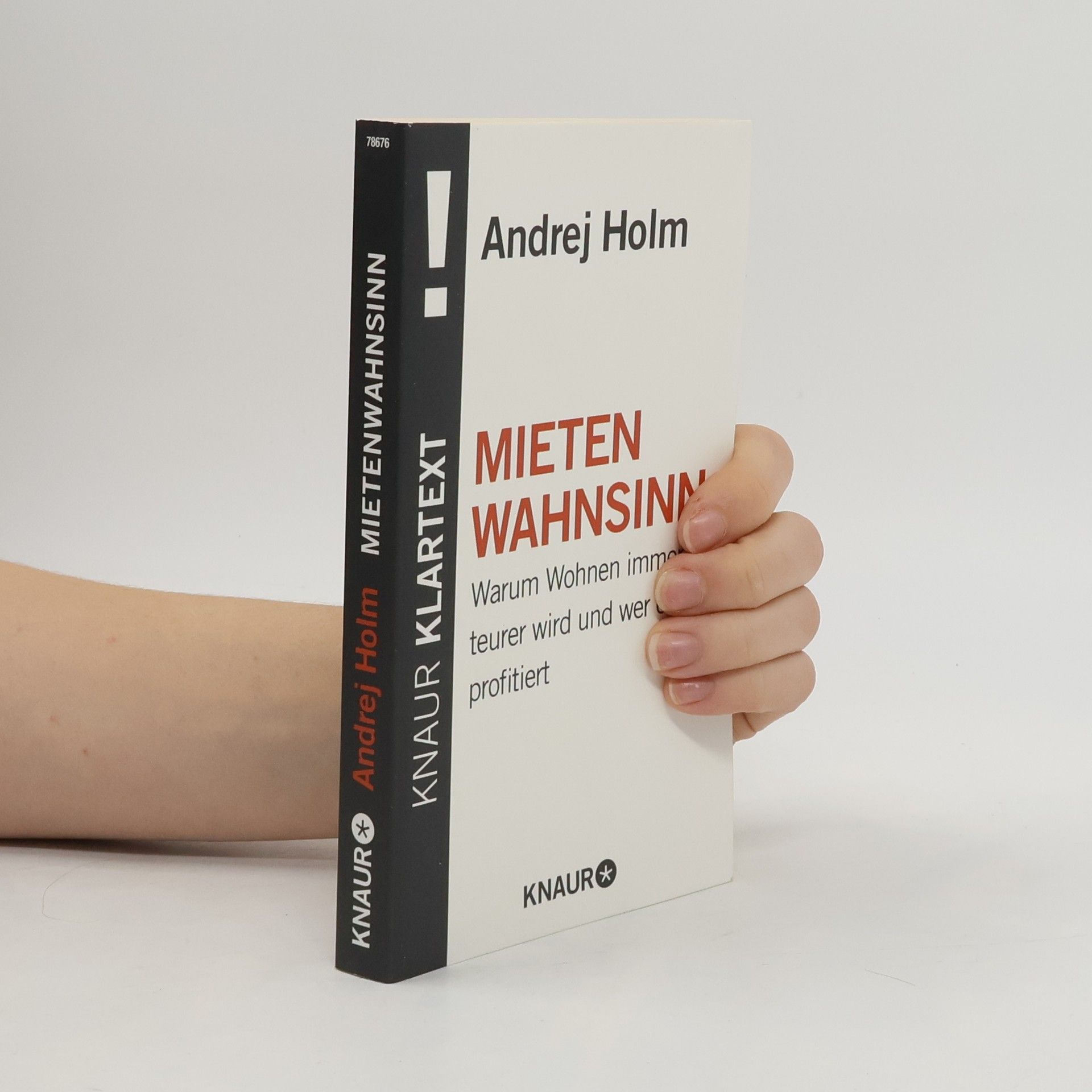
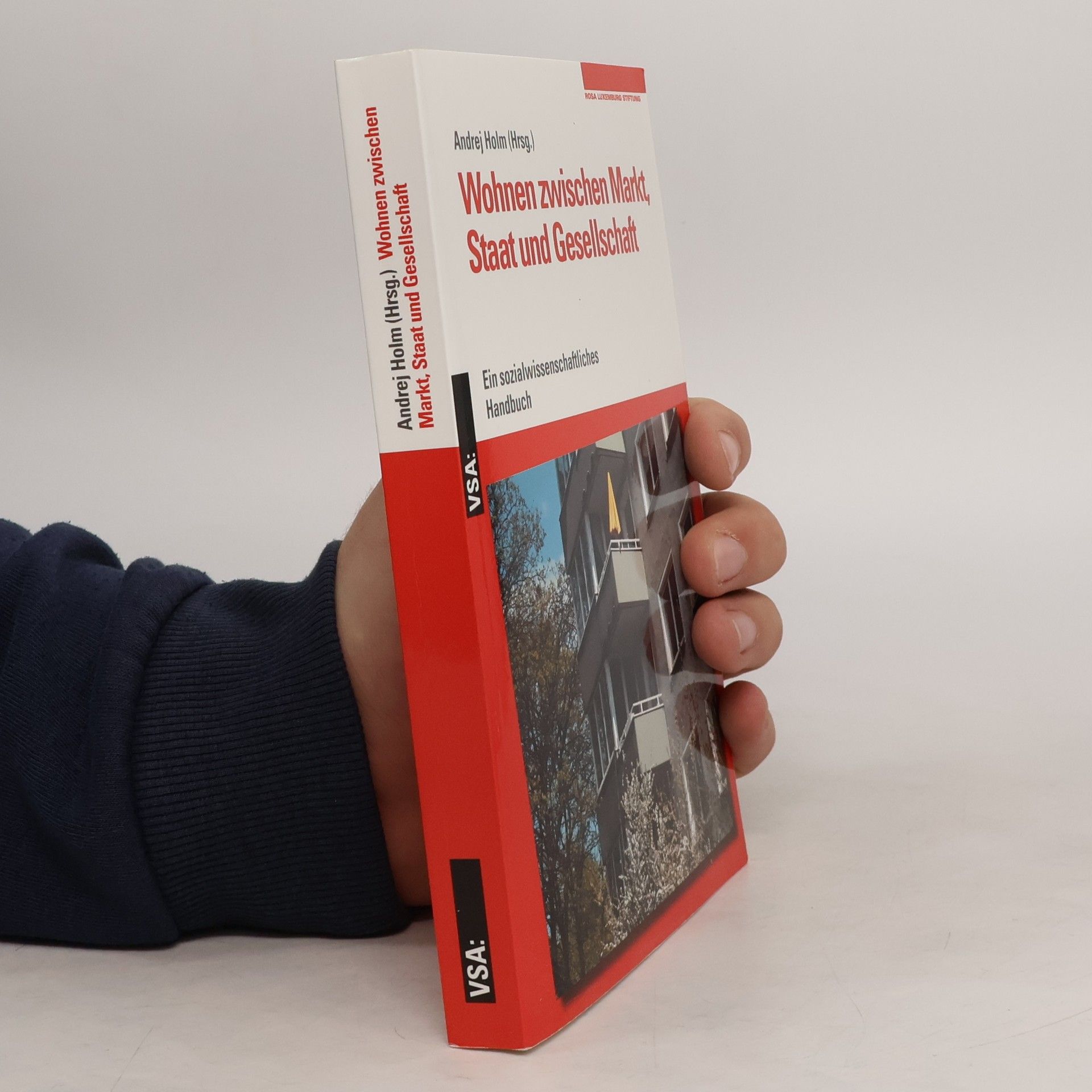

Wohnen zwischen Markt, Staat und Gesellschaft
Ein sozialwissenschaftliches Handbuch
Die Wohnungsfrage begleitet die kapitalistische Stadtentwicklung seit über 150 Jahren. Insbesondere die Diskussionen um verstärkte Regulationen wie beim Berliner Mietendeckel oder Forderungen nach der Enteignung großer Immobilienkonzerne haben der Wohnungspolitik eine neue Brisanz verliehen.Zudem ist Wohnen immer mit gesellschaftlichen Strukturen verbunden.Deshalb behandelt dieses Buch die Geschichte der Wohnungsfrage seit derIndustrialisierung. Analysiert werden außerdem aktuelle Trends des Immobilien- und Wohnungsmarktes sowie Fragen räumlicher Ungleichheit, Entfremdung, Ausgrenzung und Diskriminierung, die den Zugang zu menschenwürdigem Wohnraum für viele Menschen systematisch einschränken.Und schließlich geht es um Alternativen: Wie ist der Widerspruch zwischen Wohnen als Zuhause und Wohnen als Immobilie aufzulösen? Wo kannangesetzt werden, um eine sozial gerechte Wohnungspolitik zu erkämpfen?
Mietenwahnsinn
Warum Wohnen immer teurer wird und wer davon profitiert
Die Mieten steigen seit Monaten exorbitant, und das nicht nur in den Zentren deutscher Großstädte. Nicht selten trifft man bei Wohnungsbesichtigungen auf Hundert andere Mitbewerber – und das, obwohl man sich die Wohnung eigentlich gar nicht leisten könnte. Noch schlimmer sieht es mit Sozialwohnungen aus: Der Bedarf steigt, aber verfügbar ist immer weniger. Warum handelt die Politik nicht? Oder kommt sie gegen die übermächtige Immobilienwirtschaft nicht an? Dr. Andrej Holm, Experte für Wohnungspolitik und Europäische Stadtpolitik, erklärt, wie es zu diesem Desaster kommen konnte. Er wirft dem Staat Versagen vor, denn dieser habe sich Jahrzehntelang auf das Geschäft mit den Wohnungen eingelassen – statt langfristig für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen.
Objekt der Rendite
Zur Wohnungsfrage, oder: was Engels noch nicht wissen konnte
Wohnen ist alles andere als eine Privatangelegenheit. Als Ausdruck sozialer Verhältnisse und Gegenstand politischer Auseinandersetzungen hat das Wohnen einen zutiefst gesellschaftlichen Charakter. Das wusste schon Friedrich Engels. Im Spannungsfeld von Markt, Staat und Alltagspraxen spiegeln sich in den Wohnverhältnissen aber nicht nur die grundlegenden Konflikte unserer Gesellschaft, sondern Wohnen kann auch die Arena politischer Emanzipation und gesellschaftlicher Transformation sein.
Reclaim Berlin
- 364 Seiten
- 13 Lesestunden
Initiativen für ein Recht auf Stadt
Theorie und Praxis städtischer Aneignungen
- 286 Seiten
- 11 Lesestunden
Immer mehr Initiativen fordern eine Beendigung von Ausgrenzung und Diskriminierung sowie ihre Beteiligung am städtischen Leben. Ihre Parole nach einem "Recht auf Stadt" geht auf den französischen Soziologen Henri Lefebvre zurück, der sie in den 1960er Jahren als ein "Recht auf den Nichtausschluss" von den Qualitäten und Leistungen der urbanisierten Gesellschaft konzipierte. Seine Thesen werden in diesem Band diskutiert.Zusätzlich geht es um die Erfahrungen städtischer Proteste:– des Netzwerkes "Recht auf Stadt" in Hamburg,– der sozialen Kämpfe von SexarbeiterInnen in Madrid,– von "irregulären" MigrantInnen in Barcelona und Den Haag,– der StraßenhändlerInnen in Dhaka,– gegen Tourismus-Gentrifizierung in San Telmo (Buenos Aires),– der Wohnungslosenbewegung in Brasilien und– für gegenkulturelle Räume in Istanbul.Als ein spannendes Gegenmodell zur neoliberalen Neuordnung des Städtischen wird zudem die in Virginia (USA) entwickelte Vision eines "kommunalen Sozialismus" vorgestellt – einer von vielen möglichen Wegen, das Recht auf Stadt in die Praxis umzusetzen.Aus den Ansätzen der internationalen "Right to the City"-Bewegungen können Impulse für stadtpolitische Initiativen hierzulande gewonnen werden: möglichst breite Bündnisse und vielfältigste Aktionsformen. Eine (Re)Politisierung der Stadtentwicklung ist möglich!