Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht Bd. 3: Kollektives Arbeitsrecht I
- 1750 Seiten
- 62 Lesestunden


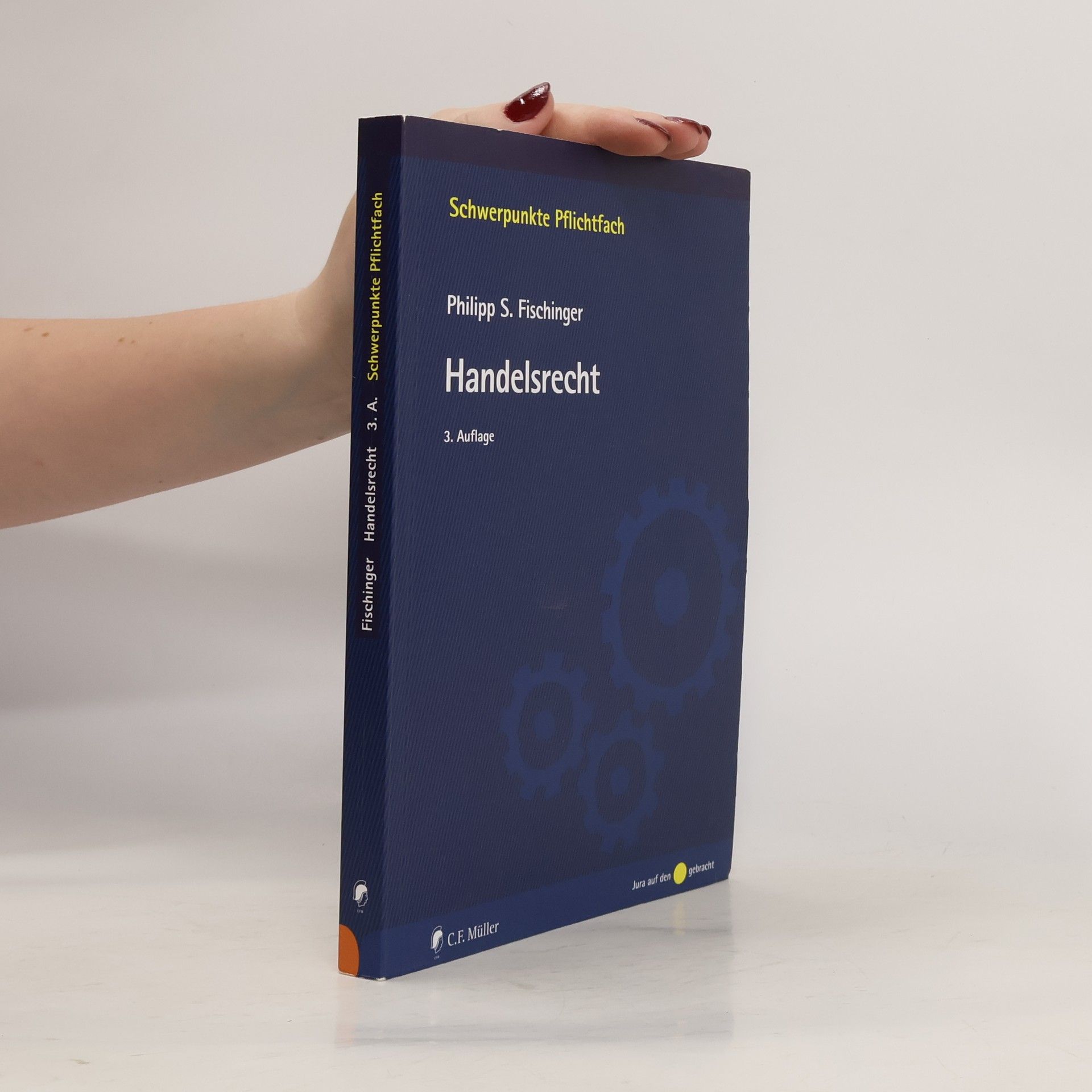



Das Werk behandelt zentrale arbeitsrechtliche Fragen im Profisport, einschließlich der Arbeitnehmerrechte von Sportlern und Trainern, der Bedeutung von Verbandsrecht, medizinischen Untersuchungen und Diskriminierung. Es bietet praxisnahe Lösungen und richtet sich an Sportvereine, Spielerberater und Anwälte.
Dieses Lehrbuch zum Handelsrecht dient in erster Linie der Vorlesungsbegleitung und Prüfungsvorbereitung von fortgeschrittenen Jurastudierenden im Pflichtfach. Es stellt klar und einprägsam die examensrelevanten Grundlagen und Grundbegriffe des Handelsrechts dar, behandelt neben den Arten von Kaufleuten, den Handelsgeschäften, den handelsrechtlichen Besonderheiten der Stellvertretung (Prokura, Handlungsvollmacht) und dem Handels- und Unternehmensregister auch eingehend die Haftung bei der Übertragung von Handelsgeschäften und gibt einen ersten Überblick zu den Kaufmännischen Geschäftsmittlern (Kommissionär, Handelsvertreter, Handelsmakler u. a. m). Ein besonderes Augenmerk gilt den Querverstrebungen zum allgemeinen Zivilrecht, da das Handelsrecht nicht selten als Einstieg oder Sonderfrage in eigentlich im „klassischen“ BGB angesiedelten Klausuren dient. Viele Beispiele aus der Praxis, über 70 Fälle mit Lösungsskizzen und zahlreiche Prüfungsschemata machen den Lernstoff anschaulich, erleichtern so das Verständnis für komplexe handelsrechtliche Zusammenhänge und schulen die Klausuranwendung des Erlernten.
Band 9/1b des Standardwerkes zum BGB enthält in bewährter Qualität umfangreiche Erläuterungen zum Dienstvertrag und ähnlichen Verträgen wie dem Arbeitsvertrag, speziell der Vorschriften der Beendigung und der Kündigung. Ein weiterer Schwerpunkt stellt der Behandlungsvertrag dar, der erstmals durch das Patientenrechtegesetz in das BGB aufgenommen worden und seit 2013 gesetzlich geregelt ist. Kommentiert wird ebenfalls das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
Dieses neue Lehrbuch zum Arbeitsrecht dient in erster Linie der Vorlesungsbegleitung und Prüfungsvorbereitung von fortgeschrittenen Jurastudierenden im Pflichtfach. Es stellt klar und einprägsam die Grundlagen und Grundbegriffe des Arbeitsrechts dar und erläutert diejenigen Bereiche aus dem Arbeitsrecht intensiv sowie klausur-didaktisch vertieft, die im Hinblick auf Examensrelevanz bedeutsam sind.Behandelt werden daher u.a.die Grundlagen und der Arbeitsnehmerbegriff, die Begründung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses, die Diskriminierungsverbote des AGG, betriebliche Übung und Gleichbehandlungsgrundsatz, die Haupt- und Nebenpflichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Haftungsbesonderheiten im Arbeitsleben, die Befristung von Arbeitsverhältnissen sowie die Änderung von Arbeitsbedingungen. Viele Beispiele aus der Praxis, über 80 Fälle mit Lösungsskizzen und zahlreiche Prüfungsschemata machen den Lernstoff anschaulich, erleichtern so das Verständnis für komplexe arbeitsrechtliche Zusammenhänge und schulen die Klausuranwendung des Erlernten. Ein abschließendes Kapitel ist der arbeitsrechtlichen Klausur und ihrem Aufbau gewidmet.