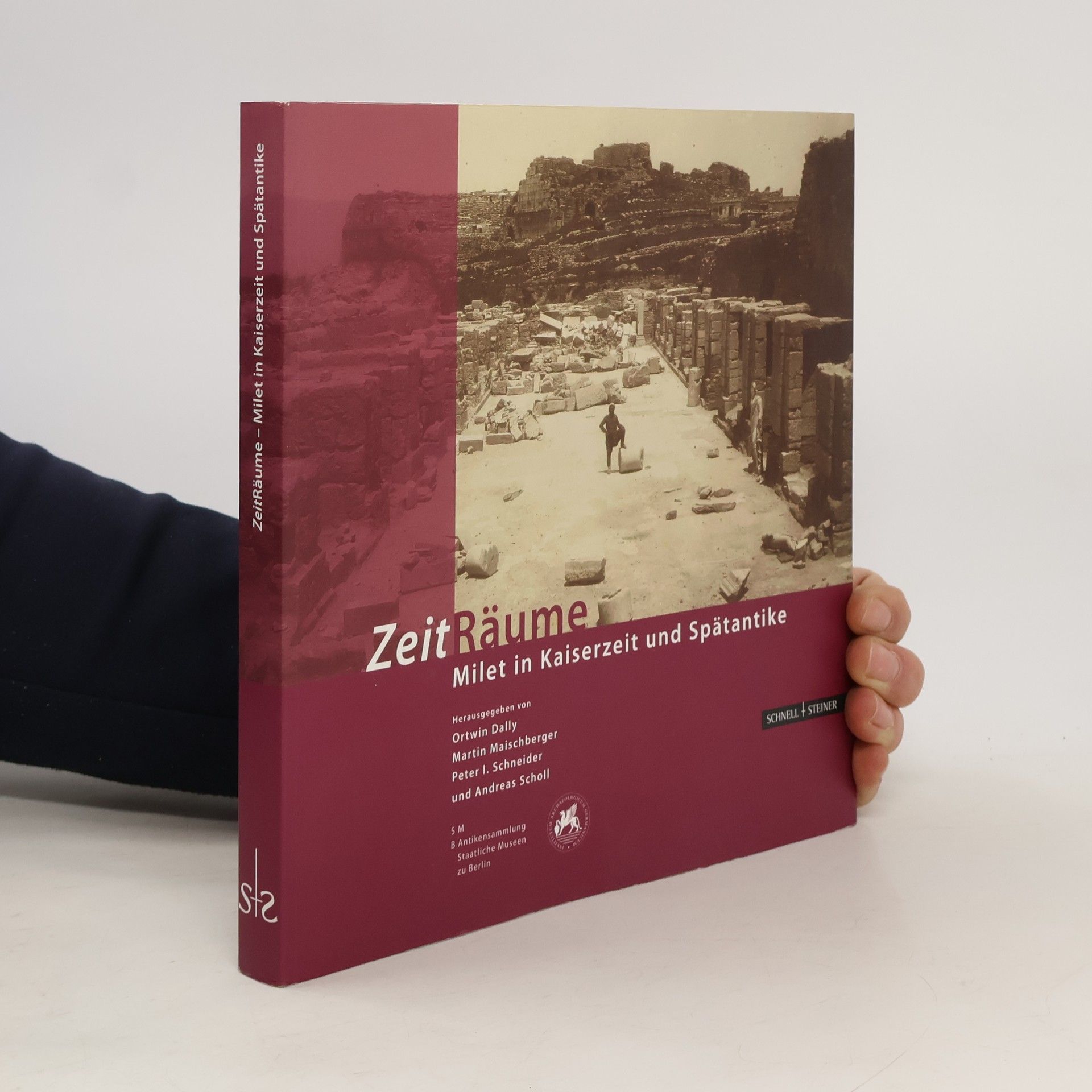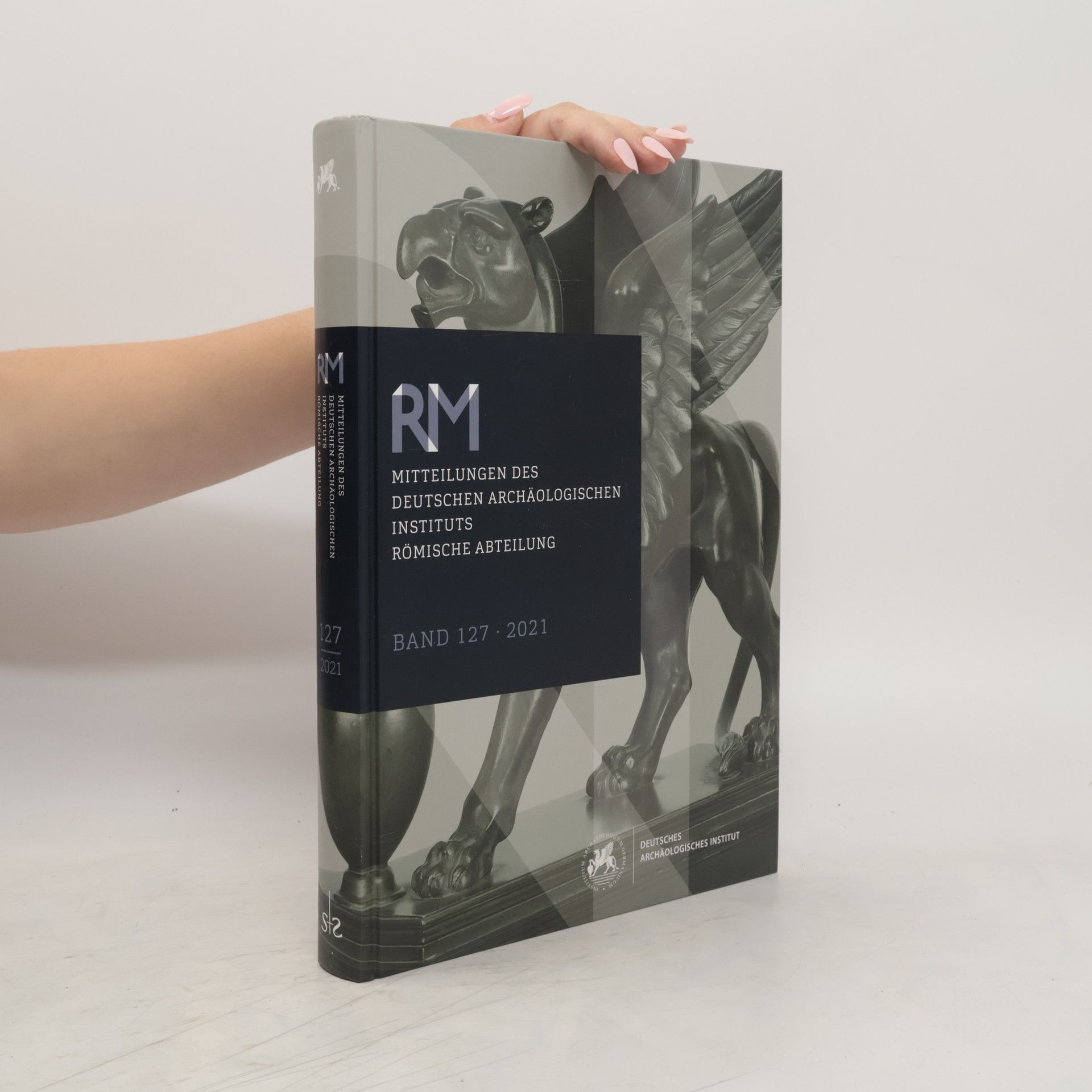Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung
Band 127, 2021
- 380 Seiten
- 14 Lesestunden
Die Römischen Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts sind eine jährlich im Dezember zur Winckelmann-Adunanz erscheinende Zeitschrift. Sie fördern den internationalen wissenschaftlichen Austausch in den Bereichen Archäologie, Kunst und Architektur Italiens und angrenzender Gebiete. Die Zeitschrift versteht sich als Plattform für die Vorstellung und Diskussion der materiellen Kultur von der prähistorischen Zeit bis ins Frühmittelalter mit traditionellem Schwerpunkt auf der klassischen Antike. Veröffentlicht werden Beiträge von Einzelstudien bis zu Überblicken von Grabungsergebnissen, die ein doppeltes blindes Peer-review-Verfahren durchlaufen haben. Inhaltsverzeichnis https://download.schnell-und-steiner.de/ihv/9783795437176_inhaltsverzeichnis.pdf