Michael Stricker Bücher
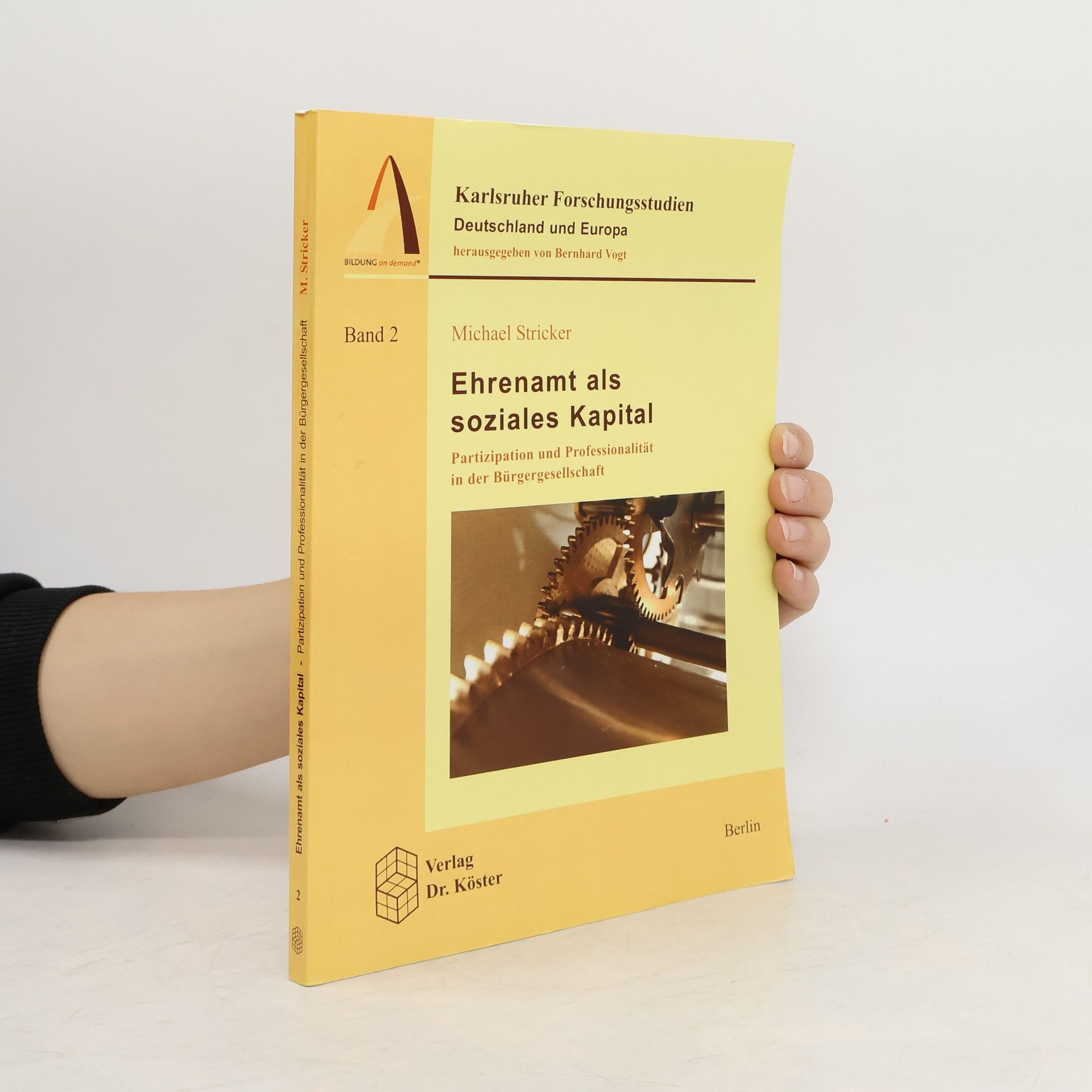

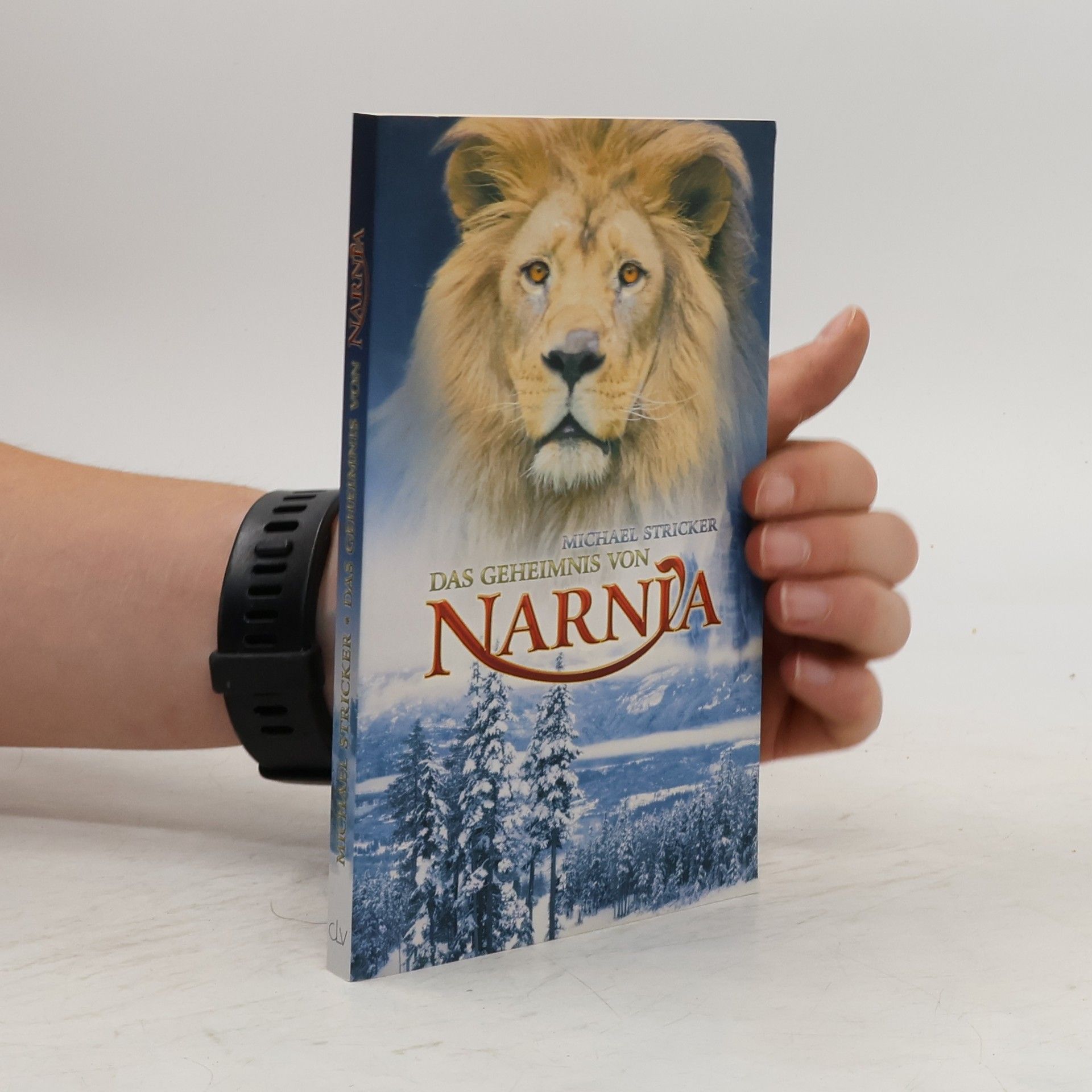
Der 1. Mai 1989
Chronik eines Polizeieinsatzes
Ehrenamt als soziales Kapital
- 240 Seiten
- 9 Lesestunden
In den letzten Jahren haben die Begriffe „Zivilgesellschaft“, „Bürgergesellschaft“ und „Sozialkapital“ an Bedeutung gewonnen, insbesondere angesichts der Krise des Wohlfahrtsstaates, die den Ruf nach individueller und gesellschaftlicher Selbsthilfe verstärkt hat. Die Arbeit untersucht bürgerschaftliches Engagement im Kontext des Ehrenamtes und integriert Sozialkapitaltheorien. Diese Theorien erklären, wie ehrenamtliches Engagement Gesellschaftsstrukturen schafft, die Probleme des kollektiven Handelns überwinden. Gleichzeitig wird aufgezeigt, dass individuelle Unterschiede im sozialen Kapital dazu führen, dass bestimmte Mitglieder der Gesellschaft von Ehrenamtstätigkeiten ausgeschlossen werden. Die Analyse wird durch ein Modell ergänzt, das Ursache-Wirkungszusammenhänge darstellt. Ein zentrales Element der Arbeit ist eine schriftliche Befragung, die beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) unter Ehrenamtlichen durchgeführt wurde. Die Wahl eines großen Wohlfahrtsverbandes ist relevant, da viele Organisationen über mangelndes Engagement klagen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Ehrenamtlichen beim ASB überwiegend sozial abgesichert, jung und männlich sind, eine gute Bildung haben und lokal verwurzelt sind. Sie qualifizieren sich häufig durch Schulungen und arbeiten regelmäßig in traditionellen Aufgabenfeldern, nehmen jedoch selten an institutionellen Meinungsbildungsprozessen teil. Die Analyse belegt, dass das freiwillige Engagement stab