Praxishandbuch Healing Code
- 136 Seiten
- 5 Lesestunden




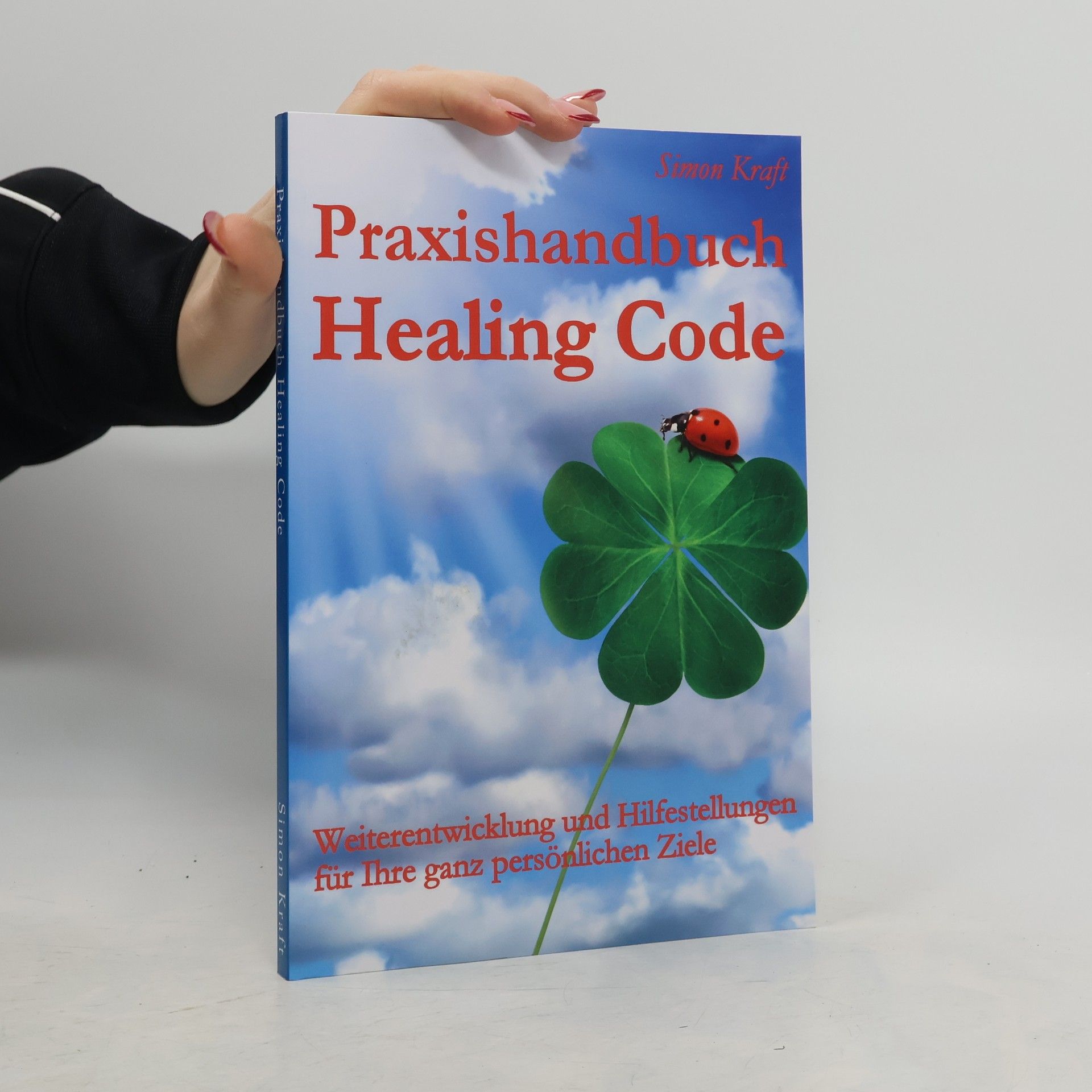
Die Jahre 1909 bis 1912 sind entscheidend für Emil Noldes künstlerische Entwicklung und legen das Fundament für seine späteren Werke. In dieser Phase gelingt ihm mit den Gemälden "Abendmahl" und "Pfingsten" der Übergang zur freien Figurengestaltung, die sein inneres Empfinden authentisch widerspiegelt. Besonders in seinen biblischen und legendären Darstellungen erreicht er eine tiefe emotionale Ausdruckskraft, die seinen künstlerischen Anspruch unterstreicht.
Architekten müssen nicht schreiben? Doch. Architektur muss kommuniziert werden – über das Schreiben ebenso wie über Pläne, Modelle und Animationen. Der Ratgeber sensibilisiert für die Bedeutung von sprachlicher Kommunikation in der Architektur, die im Studium oft vergessen und nicht kontinuierlich betreut wird. Das Entwickeln und Schreiben eines sprachlichen Konzepts ist grundlegender Teil der Entwurfsarbeit. Hinzu kommen im Studium auch das Schreiben der einen oder anderen Hausarbeit, der Bachelor- und Masterarbeit, auch promoviert wird zunehmend im Fach Architektur. Die Grundlage des Buchs ist das (sprachliche) Erarbeiten eines architektonischen Konzeptes als Ausgangspunkt für die Kommunikation darüber. Dieses ist für alle Architekt*innen gleichermaßen relevant. Stets ist es für Architekt*innen nötig, entworfene Inhalte zielgruppenorientiert zu kommunizieren – nicht nur, aber auch grundlegend über das geschriebene Wort. Mithilfe von Praxisbeispielen und Übungen werden die Grundlagen des guten Schreibens vermittelt, die nicht nur für die Kommunikation im Studium, sondern auch für das erfolgreiche Wirken als Architekt*in wichtig sind.
In allen Kulturkreisen streben die Menschen seit Jahrtausenden nach persönlichem Wachstum oder gar Erleuchtung. Aber was genau ist unter »Erleuchtung« eigentlich zu verstehen? Dieser absichtsvoll kompakt gehaltene Ratgeber liefert auf diese Frage nicht nur eine klare Antwort, er zeigt Ihnen auch einen zuverlässigen und schnellen Weg dorthin. Schritt für Schritt werden Sie einfache, aber überaus mächtige Techniken erlernen, mit denen Sie sich diesem Ziel nähern werden. Techniken, die problemlos in Ihren normalen Alltag integriert werden können - Sie benötigen lediglich etwa 30 Minuten am Tag. Mit Hilfe sorgfältig aufeinander abgestimmter Übungen erlangen Sie ein Höchstmaß an Ausgeglichenheit und innerer Ruhe. Sie werden zu sich selbst finden und wissen, was gut für Sie ist. Und ganz nebenbei wird es Ihnen gelingen, den Kontakt mit Ihren Mitmenschen zu intensivieren, in allen Lebenslagen bessere Entscheidungen zu treffen und Ihre ganz persönlichen Lebensthemen zu bearbeiten. Sie werden erstaunt sein, welche tiefgreifenden Veränderungen innerhalb von 30 Tagen mit einem Übungsaufwand von nur 30 Minuten täglich möglich sind. Probieren Sie es aus!
The essay examines the Three Kingdoms Period in Korean history, highlighting the emergence of the three empires: Koguryo, Paekche, and Silla, along with the lesser-known Kaya states. It discusses the historical context, emphasizing the significance of this era from around 313 to 668 AD, following the decline of Chinese hegemony. The author notes that while the kingdoms coexisted independently, the period culminated in Silla's rise to dominance, marking a pivotal transformation in Korea's political landscape.