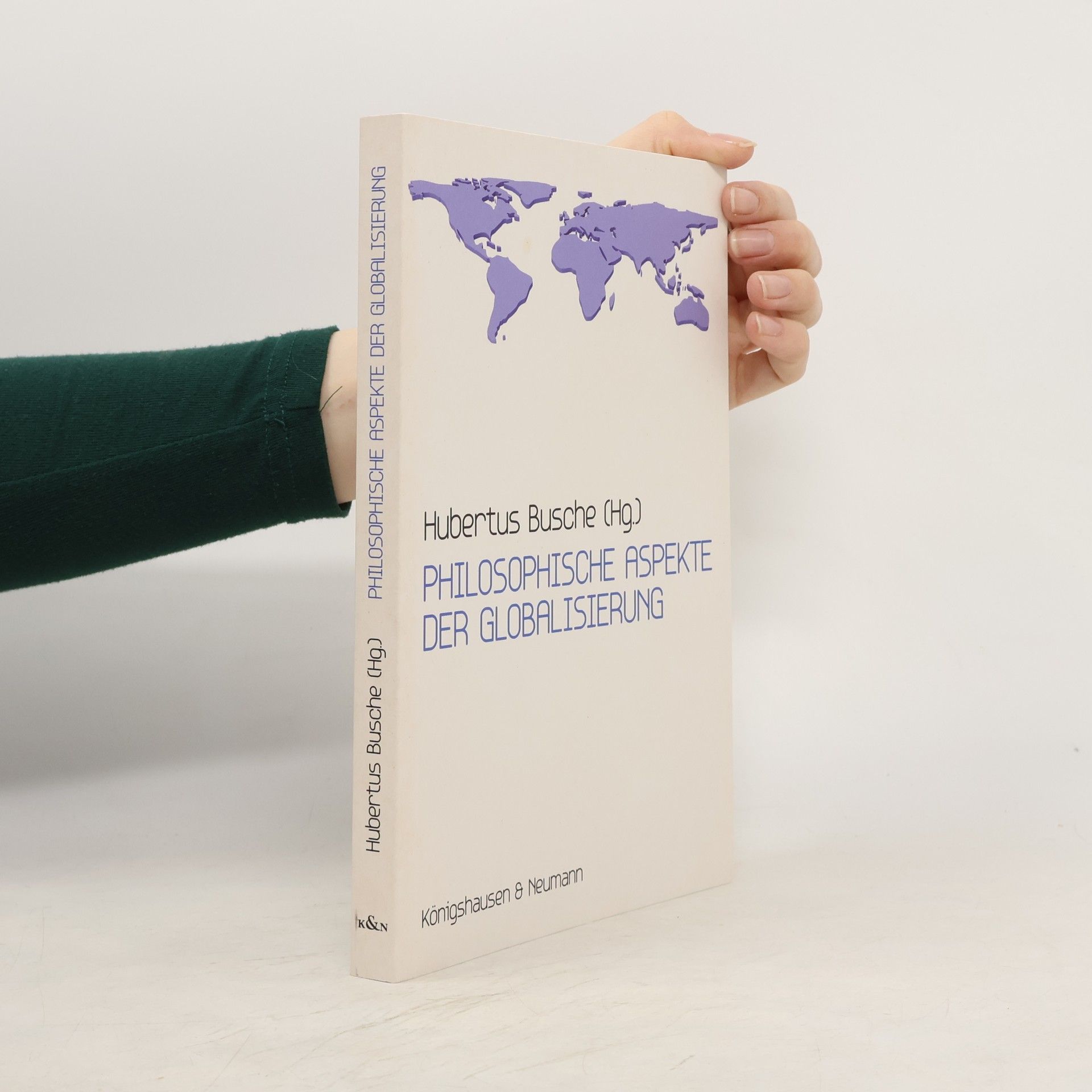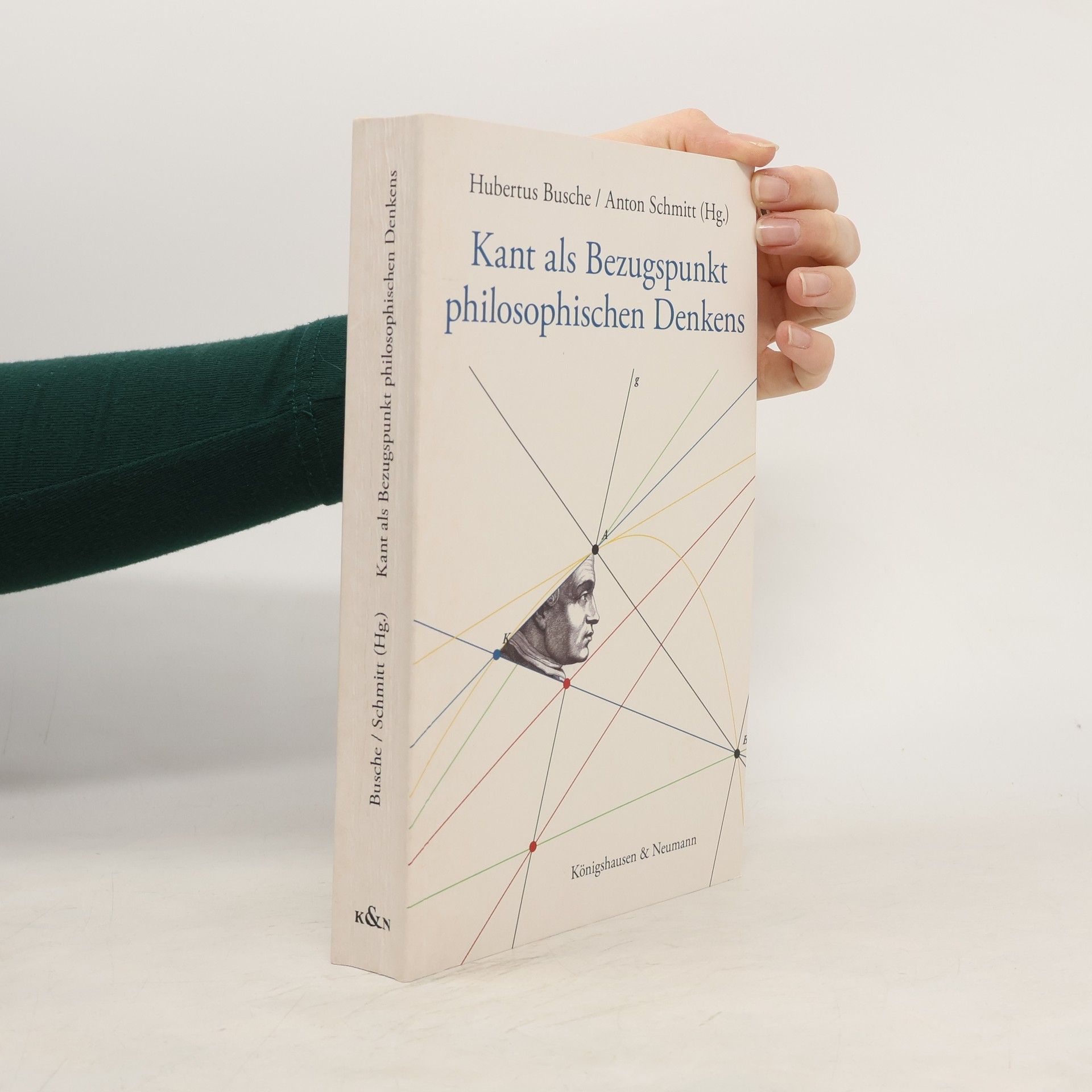Vortragsreihe der Medizinischen Gesellschaft Mainz e.V.: Zwei Philosophen der Medizin - Leibniz und Jaspers
Aus der Vortragsreihe der Medizinischen Gesellschaft Mainz e.V.
- 53 Seiten
- 2 Lesestunden
Die Medizinische Gesellschaft Mainz e. V. fördert den Austausch zwischen Medizin, Natur- und Geisteswissenschaften durch regelmäßige Veranstaltungen zu medizinisch-wissenschaftlichen Themen, deren ausgewählte Vorträge in Buchform veröffentlicht werden. In diesem Band werden die Verdienste von G. W. Leibniz und K. Jaspers für die Entwicklung der Medizin gewürdigt, wobei ihre interdisziplinären Ansätze hervorgehoben werden. Leibniz, als Vordenker der modernen Medizin, formulierte im 17. Jahrhundert wegweisende Anregungen zur Verbesserung der medizinischen Disziplin, einschließlich der Notwendigkeit von Grundlagenforschung, wissenschaftlichen Methoden, naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, der Ausbildung von Ärzten und einer staatlichen Gesundheitsstruktur. Seine Impulse legten die Grundlagen für die heutige Medizin. Jaspers, als Psychiater, trug maßgeblich zur wissenschaftlichen Entwicklung der Psychopathologie bei und setzte sich dafür ein, das Seelische mit der Methodik der Phänomenologie zu erfassen. Er respektierte die „Unendlichkeit jedes Individuums“ und seine „allgemeine Psychopathologie“ gilt als Standardwerk. Jaspers’ philosophische Arbeiten befassen sich mit den Grundbedingungen menschlicher Existenz, insbesondere in Grenzsituationen wie Krankheit und Tod, und beschreiben existentielle Krisen, in denen Menschen ihre Verletzlichkeit erkennen und zu einer neuen Stufe ihres Selbstseins gelangen können.