Sie zerstreuen, vervielfachen und verteilen sich auf verschiedenen Kontinenten, überall da, wo Konzerne rund um den Globus nach sicheren Orten suchen. Doch angefangen hat alles auf einem alten Bauernhof in Westeuropa südlich der Alpen mit einer Vision: Kein Mensch wird durch die Strahlung eines Endlagers für nukleare Abfälle getötet. Fünf Leute aus verschiedenen Nationen, eine Krankenpflegerin, ein Kraftwerk-Arbeiter, ein Nuklearphysiker, eine Finanzberaterin und eine Linguistin gründen einen Orden und entwickeln Methoden, das Wissen um die Gefahren des Atommülls verlässlich zu dokumentieren und von Generation zu Generation weiterzugeben. Verunsicherung setzt ein und zwingt den Orden zu erweiterten Aktivitäten, als der vom Konsortium versprochene Bau des Endlagers auf sich warten lässt und der Pachtvertrag gekündigt wird. Ein literarisch ungemein spannender Roman über eine uns und künftige Generationen bedrohende Materie, eingebettet in interessante Lebensgeschichten der einzelnen Akteur*innen und science-fiction-artig erzählte Zukunftsszenarien
Annette Hug Bücher
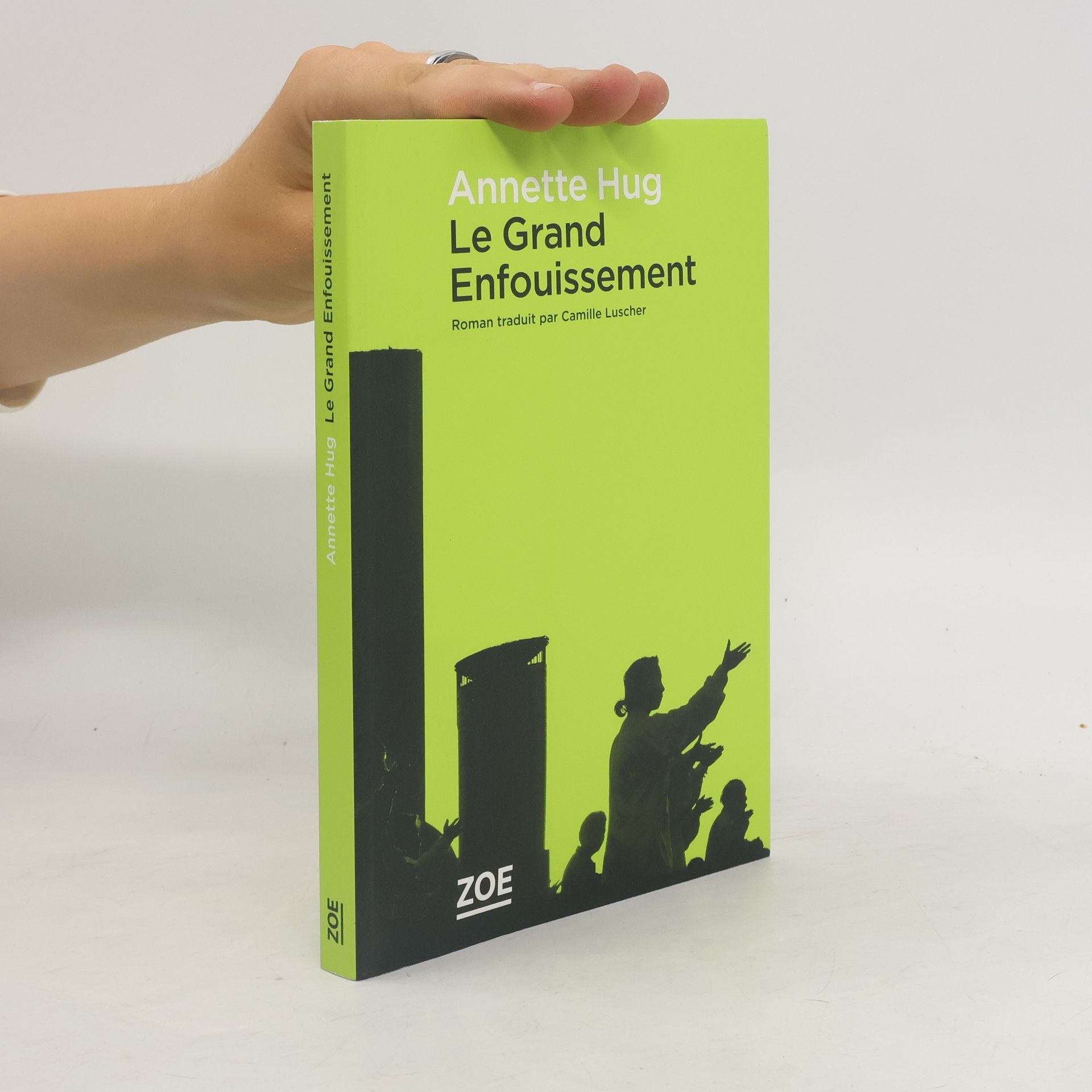

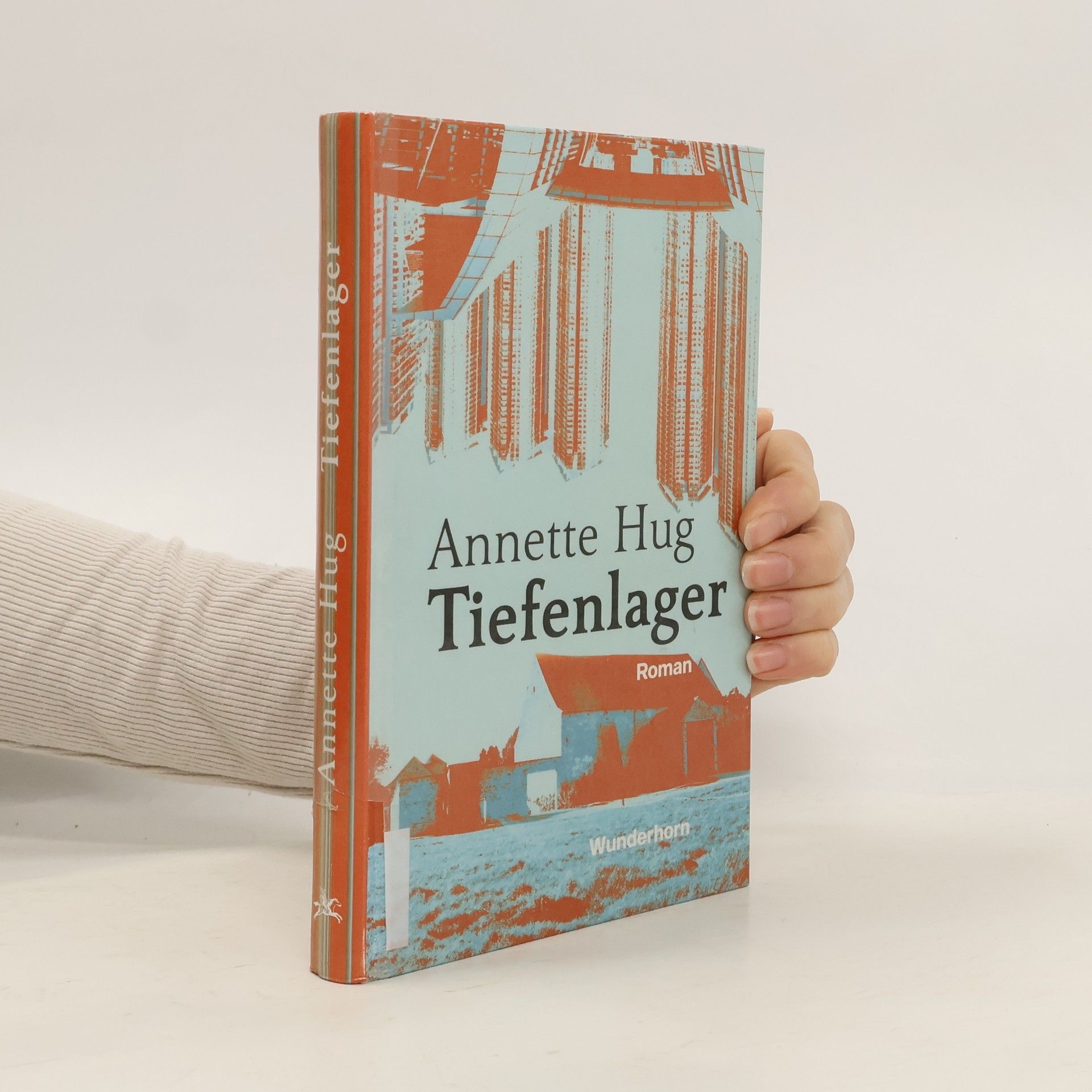
Als junger Augenarzt und Romancier kommt José Rizal 1886 nach Deutschland, ohne zu ahnen, dass er einmal Nationalheld der Philippinen werden wird. Der Archipel ist eine Kolonie des spanischen Weltreichs, in der Bildung nur in den engen Grenzen jesuitischer Klosterschulen erlaubt ist. Rizals liberalen Ideen in Madrid führen dazu, dass sein Bruder ihn vor einer Rückkehr nach Manila warnt und ihm ein Leben in Deutschland empfiehlt. In Heidelberg und Leipzig übersetzt Rizal Schillers „Wilhelm Tell“ ins Tagalog. Diese Landschaft wird zur Kulisse für seinen Protest gegen die Kolonialherren und die katholische Kirche. Rizals Aufenthalt wird zu einer Reise des Übersetzens und des Vergleichs zwischen Neuem und Vertrautem. Seine Fortbildung in Augenheilkunde, Begegnungen mit Studenten und Gespräche mit Philologen inspirieren ihn, Worte in Tagalog zu finden und Analogien zu bilden. Übersetzen wird zur Hoffnung auf einen Aufstand gegen die Kolonialherren und zur Entdeckung der Angst vor der Gewalt, die jede Ordnung zerstört. Schließlich kehrt Rizal heim, der Aufstand findet statt, und er wird 1896 in Manila wegen Anstiftung zur Rebellion verurteilt und hingerichtet. Der Roman verwebt Rizals Reisen und Begegnungen mit der Geschichte des Schweizer Freiheitshelden Tell, wobei Dichtung und Dokument fließend ineinander übergehen. Annette Hug, geboren 1970 in der Schweiz, lebt heute als freie Autorin in Zürich.