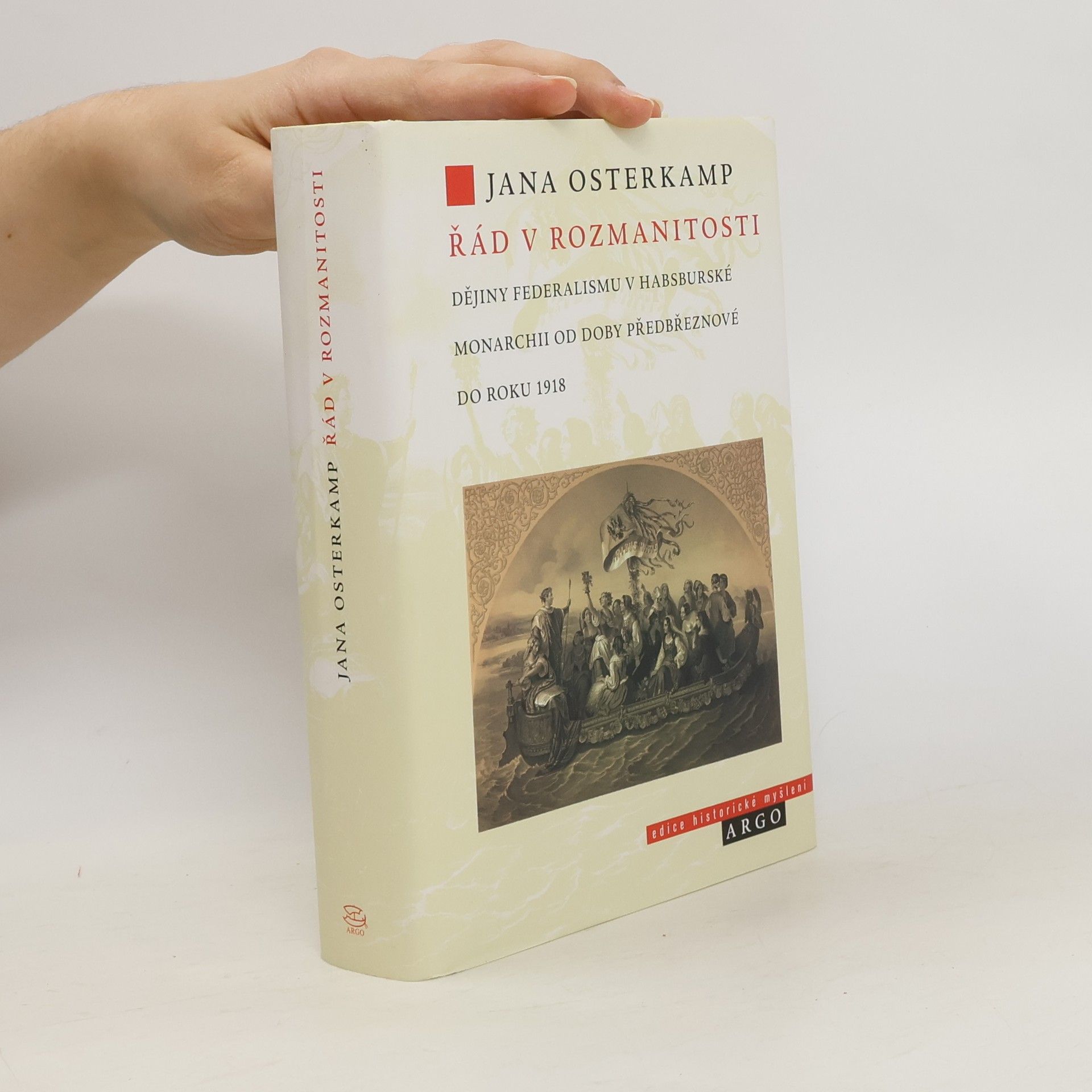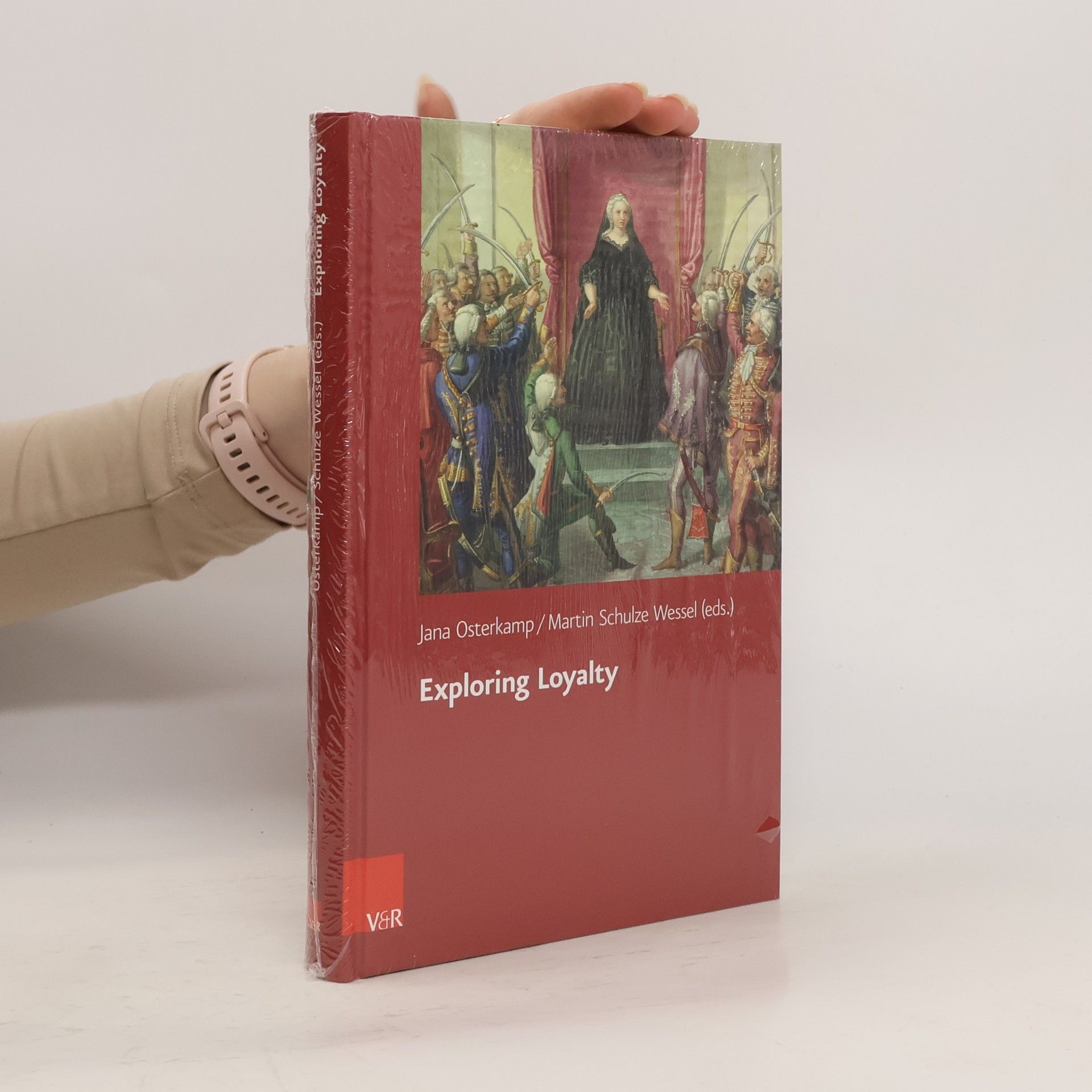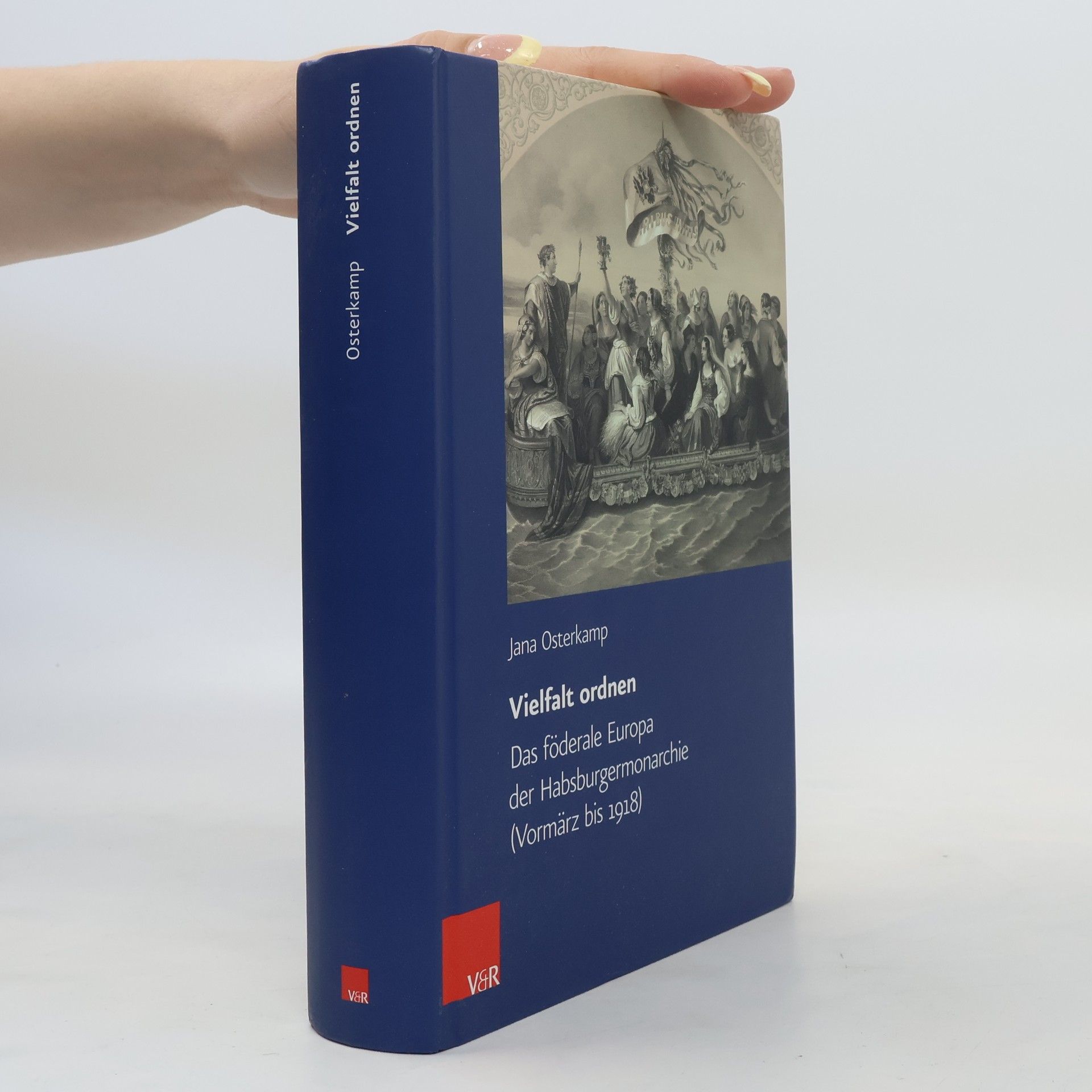Řád v rozmanitosti: Dějiny federalismu v habsburské monarchii od doby předbřeznové do roku 1918
- 644 Seiten
- 23 Lesestunden
Autorka si v knize vytkla za cíl prozkoumat nedostatečně zpracovanou problematiku federalizace habsburské monarchie. Za katalyzátor federalizačních snah považuje revoluční události, politické krize a ekonomické i hospodářské změny v podobě nerovnoměrné modernizace a industrializace. Samotnou myšlenku federalizace spojuje se snahami o nalezení funkčního modelu habsburského státu a spravedlivějšího uspořádání mnohonárodnostní monarchie. Česká otázka v podobě trialismu se tak v jejím pohledu jeví jako pouze jedna z mnoha otázek habsburské monarchie. Problematika federalizace nejsilněji rezonovala v nacionalistickém a později v socialistickém politickém prostředí, avšak nebyla cizí ani liberálům či konzervativcům. V protikladu vůči zažité představě o neúspěchu federalizace autorka ukazuje, že na rovině víceúrovňové správy sedmnácti rakouských zemí se přece jen vyvinul systém, který je možné označit za federativní. Boří tak zažitou představu, v níž je federalizace tradičně spojována až se snahami o nové uspořádání monarchie císařem Karlem na konci první světové války.