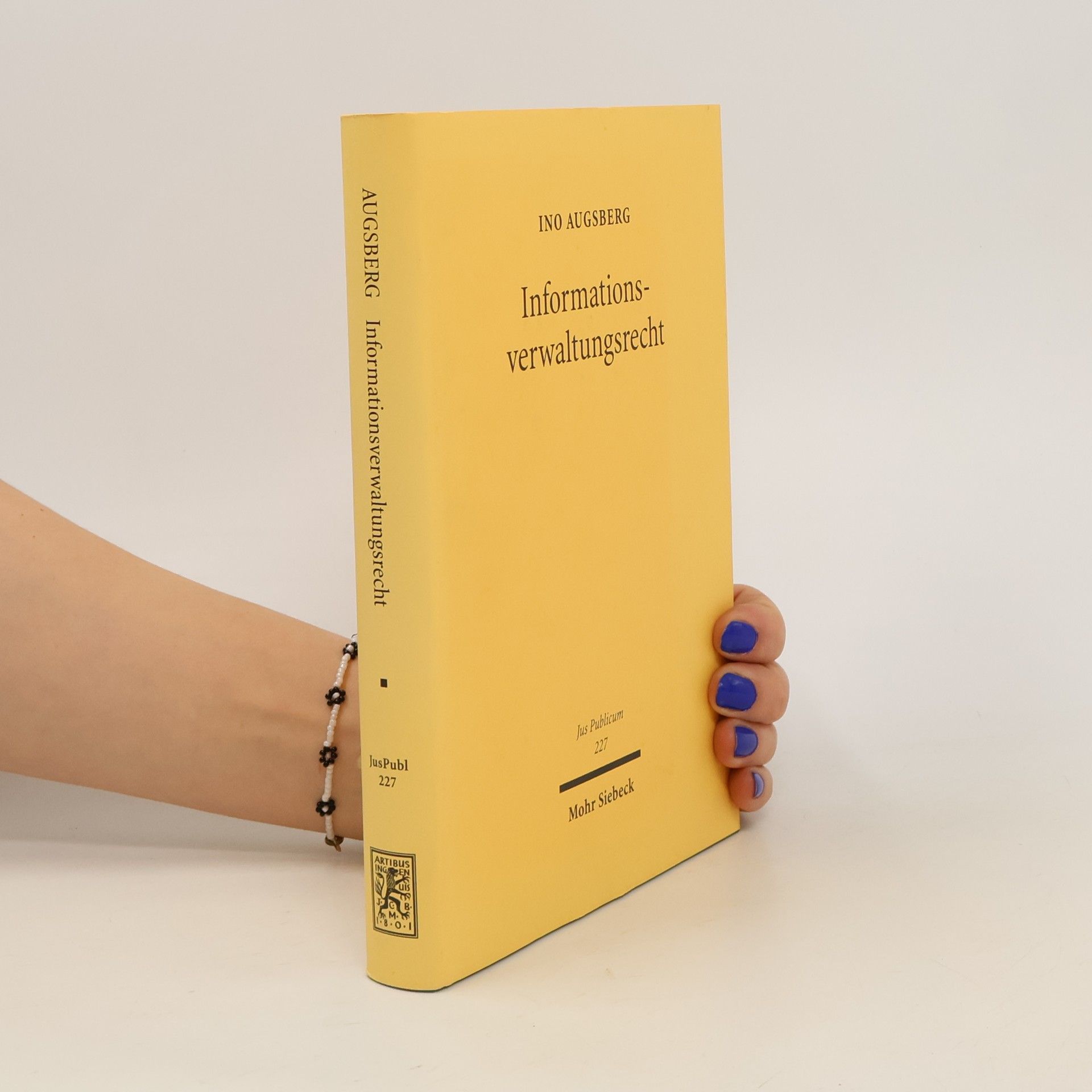Recht auf Nicht-Recht
Rechtliche Reaktionen auf die Juridifizierung der Gesellschaft
- 300 Seiten
- 11 Lesestunden
Die gegenwärtige Gesellschaft ist mit einem Phänomen konfrontiert, das sich als Juridifizierung charakterisieren lässt. Gemeint ist damit, dass juristische Kategorien zunehmend auch außerhalb genuin rechtlicher Kontexte Verwendung finden. Die Weise, wie Menschen sich selbst und ihre Lebenswelt wahrnehmen, ist danach mehr und mehr durch juristische Perspektiven vorgeprägt und damit auf spezifische Weise verengt.0Die Beiträge des vorliegenden Bandes gehen von dieser Diagnose aus und fragen nach einer spezifischen Lösungsmöglichkeit für das so bestimmte Problem: Lässt sich der Befund in das Recht selbst zurückspiegeln? Ist es möglich, das Recht gegen sich selbst und seine zunehmende Überformung der Gesamtgesellschaft in Stellung zu bringen?0Mit Beiträgen von: Ino Augsberg, Steffen Augsberg, Ricardo Campos, Ghazaleh Faridzadeh, Judith Froese, Petra Gehring, Friedhelm Hase, Andrea Klonschinski, Karl-Heinz Ladeur, Franz Reimer, Thomas Vesting, Lars Viellechner, Dan Wielsch und Benno Zabel