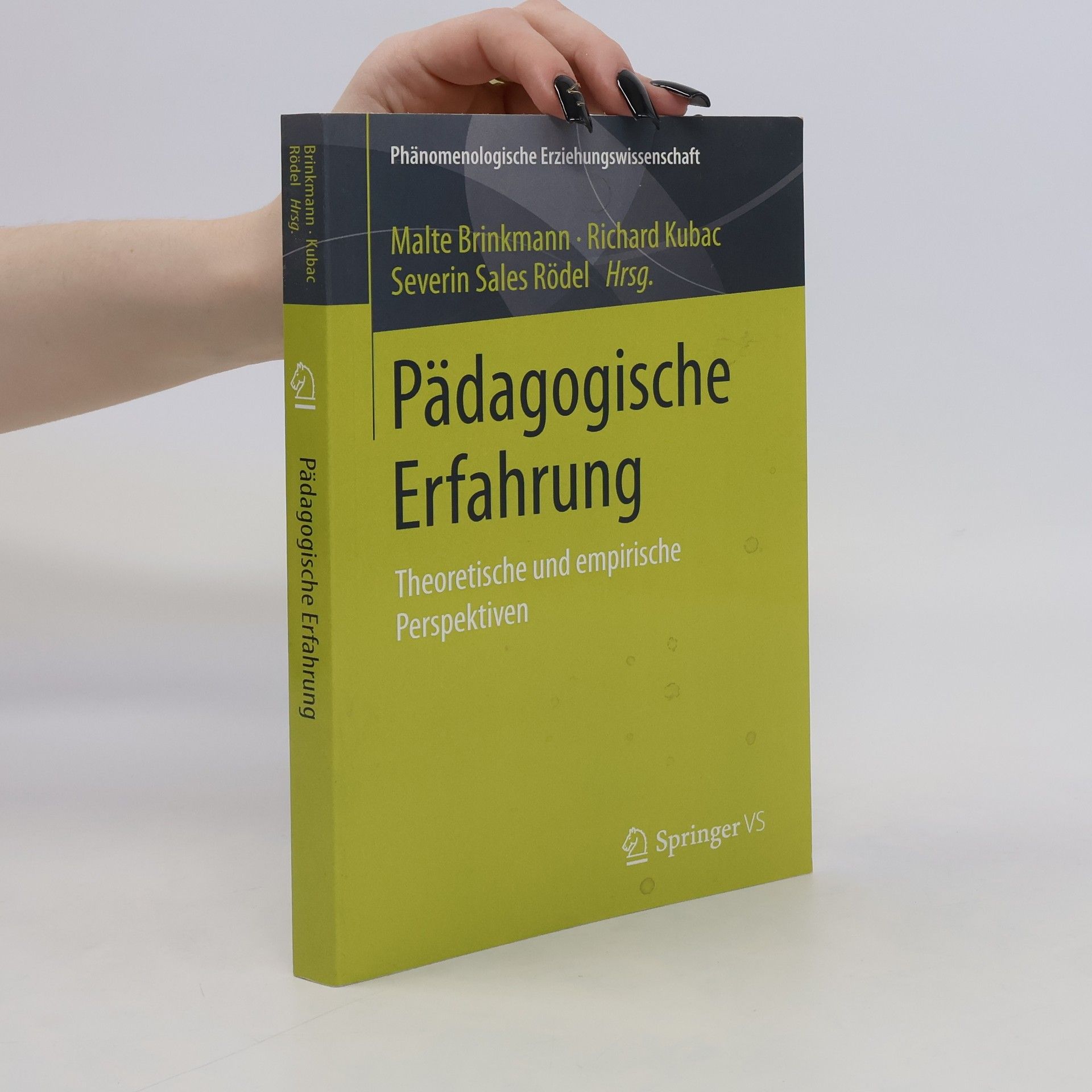Generation und Weitergabe
Erziehung und Bildung zwischen Erbe und Zukunft
Der Band nimmt die Umstrittenheit und Legitimation von Generation und Weitergabe, ihre historischen, institutionellen, gesellschaftlichen und anthropologischen Bedingungen ebenso in den Blick wie die erzieherischen und pädagogischen Praktiken und mögliche pädagogische bzw. gesellschaftliche Transformationen. Erörtert werden Generativität und Weitergabe systematisch im Verhältnis zum Begriff und zur Praxis der Erziehung und im Kontext von Krise und Klima, bildungsphilosophisch im Zusammenhang von Gabe und Weitergabe sowie institutionentheoretisch im Umfeld von Schule und Hochschule.