Keine Institution wurde in Deutschland so oft totgesagt wie das Parlament. Populisten verachten es und träumen von einer plebiszitären Demokratie. Ist parlamentarische Politik nur noch dazu da, Entscheidungen der Bundesregierung nachträglich zu legalisieren? Der Jurist Florian Meinel analysiert messerscharf, wie das deutsche Regierungssystem wurde, was es ist, und welche Stürme es heute überstehen muss. Der Erfolg der AfD stellt die politischen Gewissheiten der Bundesrepublik in Frage. Das Ende des alten Wettbewerbs der Volksparteien hat alle Verfassungsorgane erfasst. Disruptive Politik geht heute scheinbar ohne Parlament: Abschaffung der Wehrpflicht, Euro-Rettung, Flüchtlingskrise, Ehe für alle. Was oft dem Regierungsstil Angela Merkels zugeschrieben wird, hat viel tiefere Ursachen. Der missverstandene Parlamentarismus ist die verletzlichste Errungenschaft der alten Bundesrepublik. Wie lässt er sich heute fortentwickeln? Welche politische Chance läge in Minderheitenregierungen? Oder müssen wir das Zweikammersystem grundsätzlich umbauen, damit Deutschland regierbar bleibt? Meinels Buch ist eine Verteidigung des Parlamentarismus und zugleich eine Verlustbilanz der Großen Koalition.
Florian Meinel Bücher

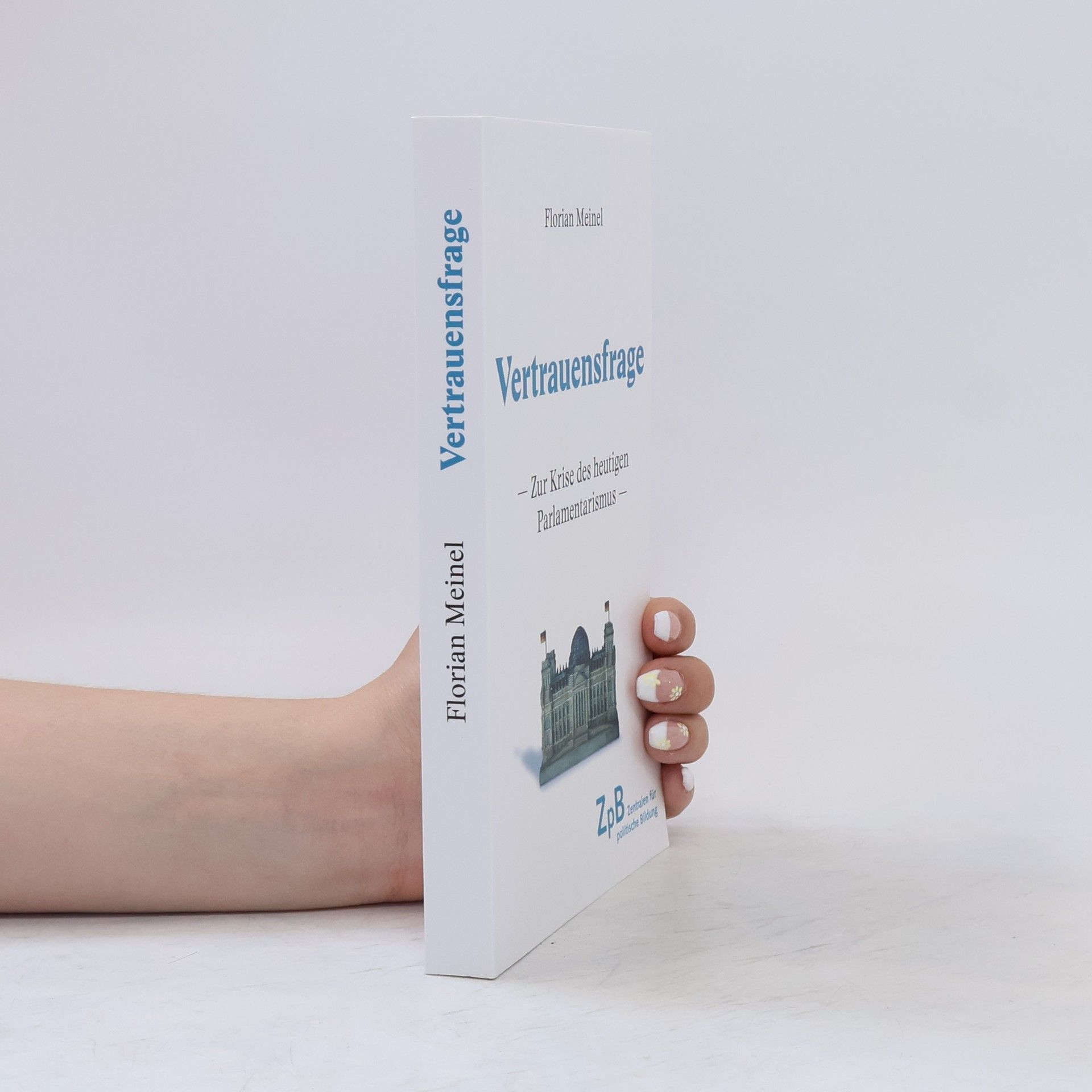
„Ich war von der Idee durchzuckt gewesen, daß die Dinge sich dem Denken ganz allgemein in blitzhaften Assoziationskaskaden eröffnen würden, und daß die Rekonstruktion dieser Blitze im nachfassenden Denken, in Schrift, im Text, das jeweilige Ding dann richtig erfassen würde, wenn DAS KLEINGEDRUCKTE dieser Rekonstruktion auch dem realen inneren Zusammenhang des Dings entsprechen würde. Dieser zirkelhafte Gedanke hatte mich euphorisiert: Protokoll der Assoziativität und Materialität, Theorie der Weltzuwendung, Absoluter Idealismus.“ Rainald Goetz Das Kleingedruckte ist Verwaltung und Verrat, Macht und Maske, Verantwortung und Versteck, Schwarzbrot und Euphorie, relativer Realismus und absoluter Idealismus. Es ist die Logik der Ampel, eine Fußnote aus dem Vatikan, die Alarmanlage des Humboldt Forums, die Bananenverordnung der EU, die AGBs globaler Ungleichheit. eine letzte kleine Ode auf Enzensberger, der neueste Newsletter mit der Ankündigung des Frühjahrsreigen und das Impressum des Zeitgeistes. Mit Beiträgen von Pascal Cancik, Rainald Goetz, Durs Grünbein, Philip Manow, Heinrich Meier, Bénédicte Savoy, Michael Seewald, Danilo Scholz und vielen weiteren.