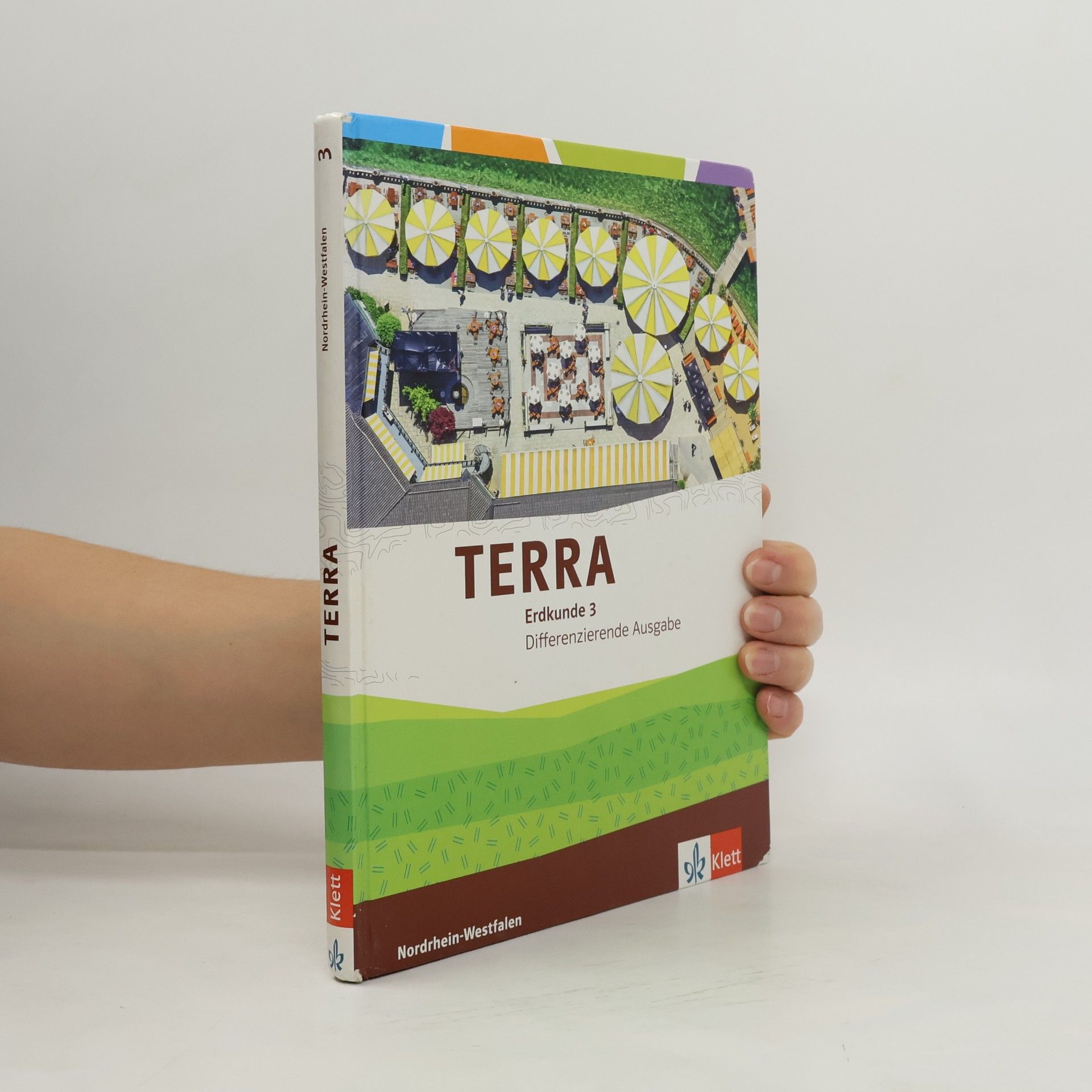Palliativmedizin - Lehrbuch für Ärzte, Psychosoziale Berufe und Pflegepersonen
- 334 Seiten
- 12 Lesestunden
Die 3. aktualisierte Auflage dieses Lehrbuchs bietet umfassendes Wissen zur medizinischen, pflegerischen, psychosozialen und seelsorgerlichen Betreuung von Menschen mit fortgeschrittenen, lebensbedrohlichen Erkrankungen. Die Autorinnen und Autoren, erfahrene Experten in der Palliativmedizin, haben die Inhalte erweitert und an aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst. Das Buch richtet sich an Fachkräfte im Gesundheitswesen sowie an alle, die mit unheilbar kranken und sterbenden Menschen arbeiten. Die Themen umfassen die Grundlagen der Palliativmedizin, die Bedeutung interdisziplinärer Teams, Schmerztherapie, Symptomkontrolle und die Rolle von Ehrenamtlichen. Weitere Kapitel behandeln spezifische Symptome wie Übelkeit, Atemnot und Fatigue sowie die psychosozialen Aspekte der Betreuung. Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, ethische Überlegungen und die Kommunikation mit Patienten und Angehörigen werden behandelt. Besonderes Augenmerk liegt auf der palliativen Versorgung in verschiedenen Altersgruppen, einschließlich der pädiatrischen und geriatrischen Palliativmedizin. Die umfassende Gliederung und die praxisnahen Beispiele machen das Buch zu einem wertvollen Nachschlagewerk für alle, die in der Palliativversorgung tätig sind.