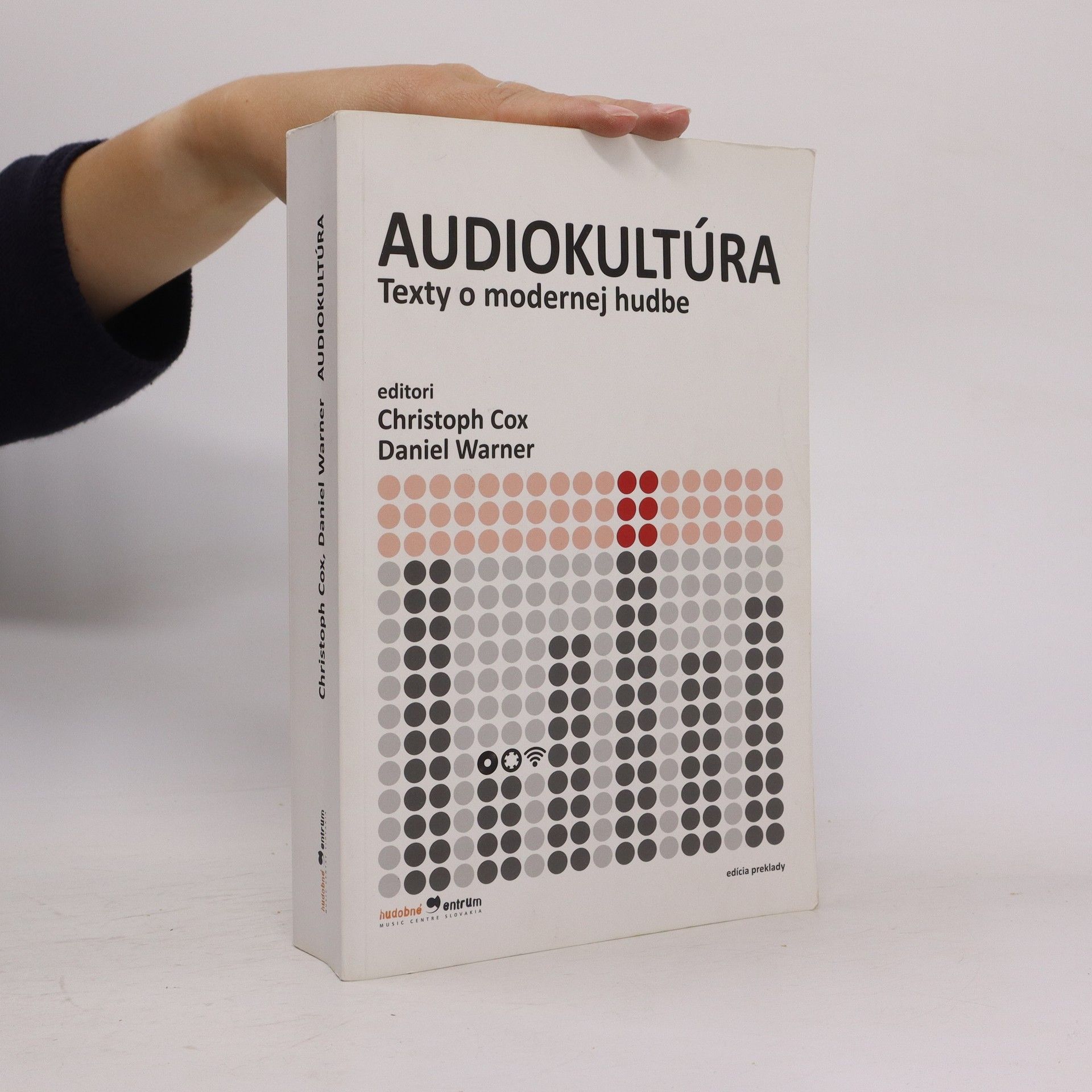Lyrische Agonistik
Das Politische in Gedichten der Gegenwart
Ausgehend von der These, dass die politische Lyrik der Gegenwart eine lyrische Streitkultur darstellt, wird in „Lyrische Agonistik. Das Politische in Gedichten der Gegenwart“ eine neuartige rhetorische Methode zur Analyse des Politischen in der Lyrik entwickelt. Diese Methode basiert auf einer philosophischen ‚neuen‘ Rhetorik und bezieht sich auf radikale Demokratietheorien, insbesondere von Chantal Mouffe und Ernesto Laclau. Zentral ist die von der sophistischen Rhetoriktradition und radikalen Demokratietheorie geteilte Skepsis gegenüber epistemischen Letztbegründungsversuchen. Das Politische in der Lyrik wird als Ablehnung fundamentaler Gründungsvorstellungen verstanden, die sich in diskursiven Verhandlungen einer stets angreifbaren Politik äußern. Diese postfundamentalistische Wende zeigt sich in gegenwärtigen Gedichten durch rhetorische Widersprüche, die den konflikthaften Charakter des Politischen verdeutlichen. Gleichzeitig wird der Versuch, umstrittene Diskurse hegemonial zu gestalten, thematisiert. Anhand von drei Textbeispielen politischer Lyrik der letzten zehn Jahre – Tom Schulz’ „Die Maschinen sind volljährig“, Günter Grass’ „Was gesagt werden muss“ und Monika Rincks „was machen die frauen am sonntag?“ – wird das Spiel von Kontingenzerfahrung und Schließungsbemühungen verdeutlicht.