Dieser Band widmet sich der Geschichte der Karolinger, des Herrschergeschlechts der westgermanischen Franken, mit Karl dem Großen als bekanntestem Vertreter. Er beleuchtet den Aufstieg Pippins des Jüngeren 751 und die Rolle der Kirche als Machtfaktor im Frankenreich.
Karl Ubl Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
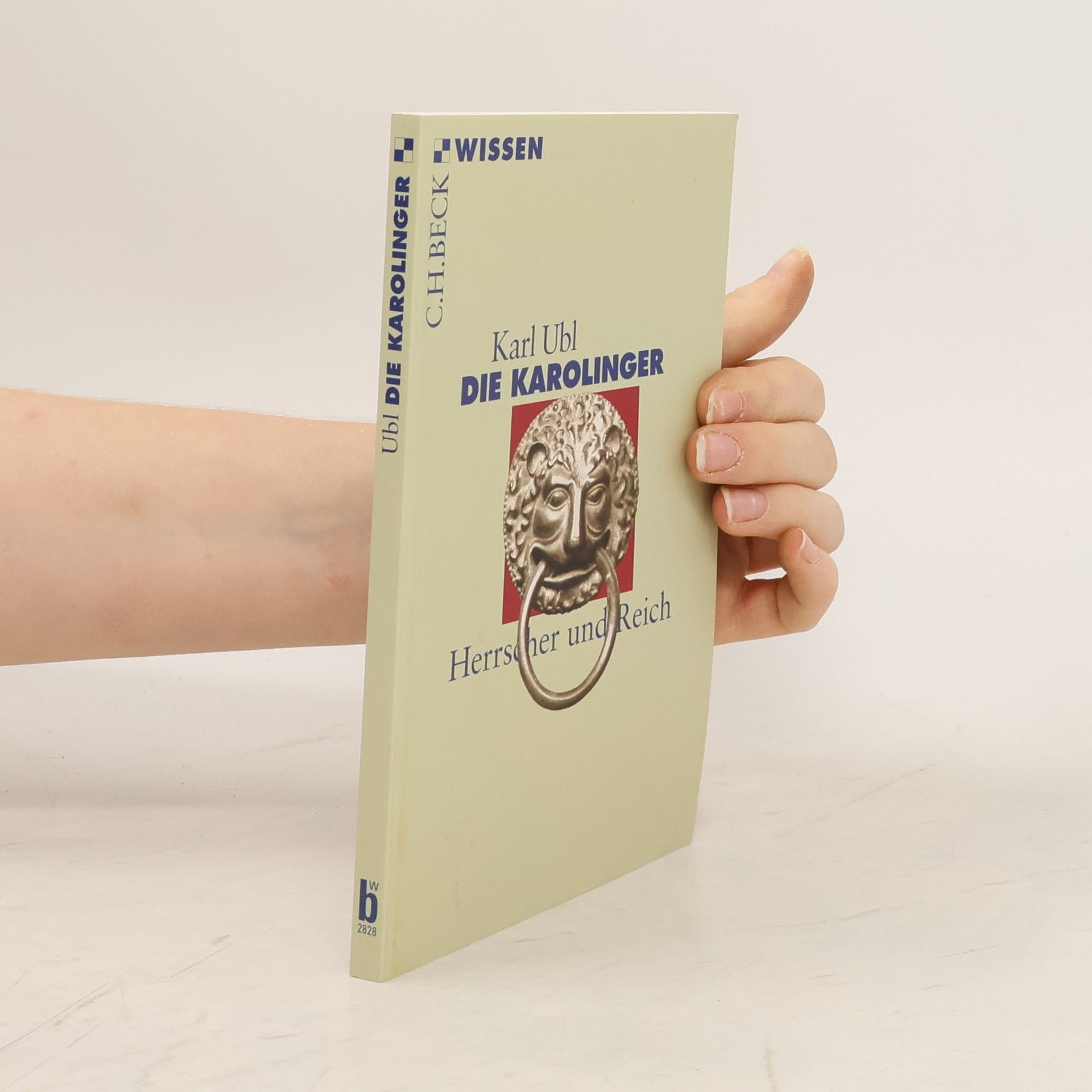


Köln im Frühmittelalter (400 - 1100)
Die Entstehung einer heiligen Stadt. Das Köln von früher entdecken. Fundierte Einblicke in die Stadtgeschichte Kölns
- 512 Seiten
- 18 Lesestunden
Die Entwicklung Kölns im frühen Mittelalter wird von Karl Ubl detailliert untersucht, wobei er die gängige Auffassung über die Bedeutung des Erzbischofs Brun im 10. Jahrhundert in Frage stellt. Er beschreibt, wie die Stadt nach der Völkerwanderung durch den Bau zahlreicher Kirchen und die Entstehung der Kölner Heiligenlegenden ein neues Gesicht erhielt. Ubl beleuchtet die Transformation von Agrippina zu Sancta Colonia und zeigt, wie Köln sich als bedeutende heilige Stadt hinter Rom und Jerusalem positionierte. Dabei wird auch der wirtschaftliche und demographische Aufschwung während der Karolingerzeit thematisiert.
Die Karolinger
- 128 Seiten
- 5 Lesestunden
Die Karolinger - so lautet der Hausname des Herrschergeschlechts der westgermanischen Franken. Sein berühmtester Vertreter war Karl der Große. Im Jahr 751 trat mit Pippin dem Jüngeren der erste Herrscher an die Spitze des Frankenreichs, der nicht mehr der alten Königsdynastie der Merowinger entstammte. Das neue Herrscherhaus hat sich mehr als einhundert Jahre erfolgreich um Ausbau und Stabilität des Frankenreichs verdient gemacht und die Kirche als bedeutenden Machtfaktor in die Regierungsgeschäfte eingebunden. So ist dieser konzise geschriebene Band den Karolingern und ihrer Geschichte gewidmet.