Maria und ihre Heiligtümer in der Kultur der Gegenwart
Modelle, Kommunikation, Perspektiven
Manfred Hauke ist ein Theologe, dessen Werk sich mit dem breiten Feld der Dogmatik beschäftigt. Seine Schriften befassen sich mit Themen wie dem Priestertum der Frauen, der Erbsündenlehre bei den griechischen Kirchenvätern und der Mariologie. Haukes Ansatz ist tief in der Tradition verwurzelt und doch offen für zeitgenössische theologische Diskussionen, was den Lesern fesselnde und aufschlussreiche Einblicke in komplexe Glaubensfragen bietet.




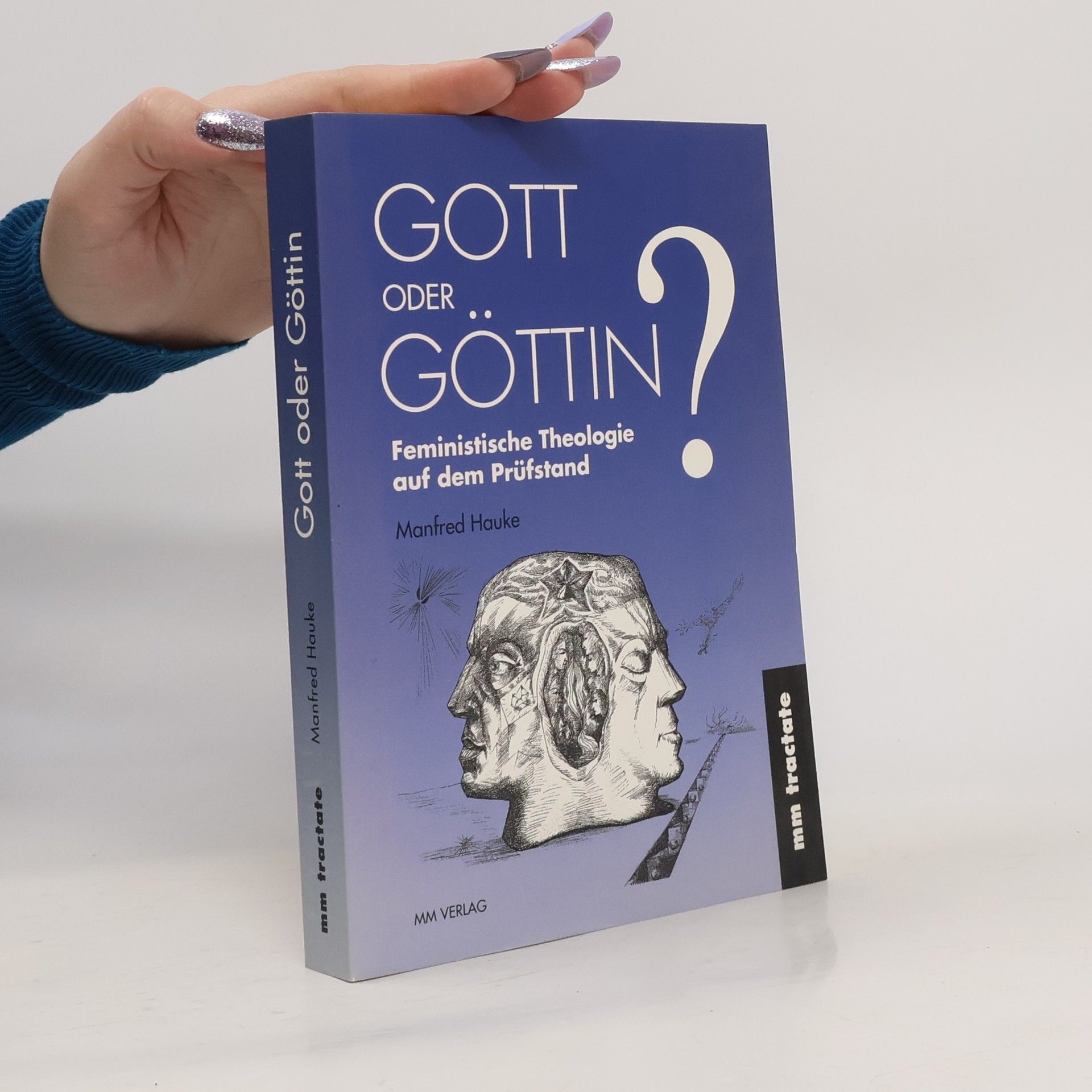
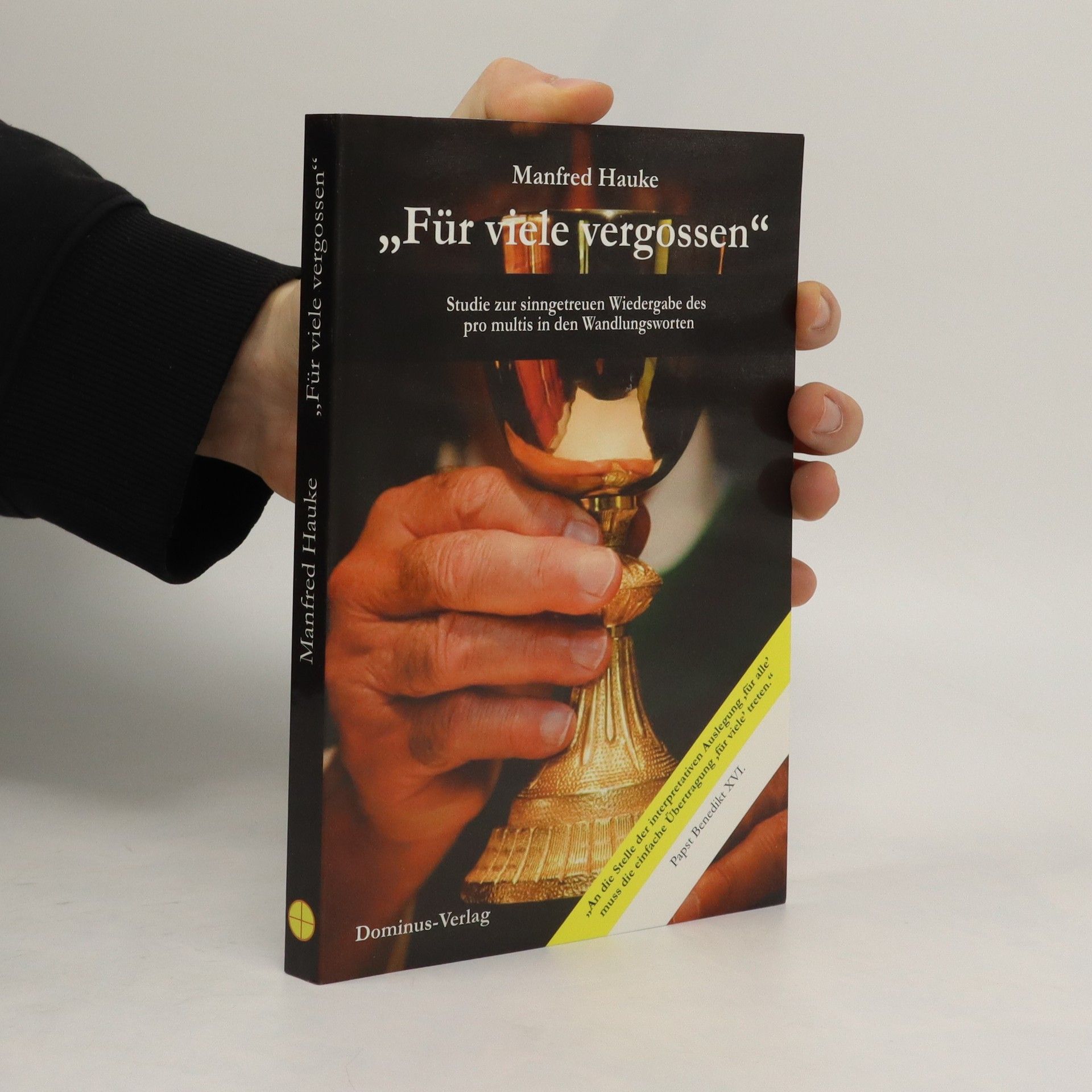
Modelle, Kommunikation, Perspektiven
Vergangenheit, Gegenwart und Herausforderungen für die Zukunft
"A panoramic synthesis of Mariology and the biblical foundation and development of Marian doctrine"--
Geschichte, Botschaft, Relevanz
Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der Marienerscheinungen von Fatima werfen deutschsprachige Mariologen einen perspektivenreichen Blick auf die Ereignisse und die Folgen. Analysiert werden die Quellen der Mariophanien, insbesondere das erst 2013 teilweise veröffentlichte Werk der wichtigsten Seherin, Sr. Luzia. In den Blick genommen wird außerdem die Wegbereitung der Botschaft von Fatima im Werk der seligen Maria Droste zu Vischering. Die Beziehung zum Islam wird vertieft durch eine „Spurensuche“ im Licht des Namens „Fatima“. Weitere Beiträge untersuchen die Rezeption des Fatimageschehens im deutschsprachigen Raum, Russland und Polen.