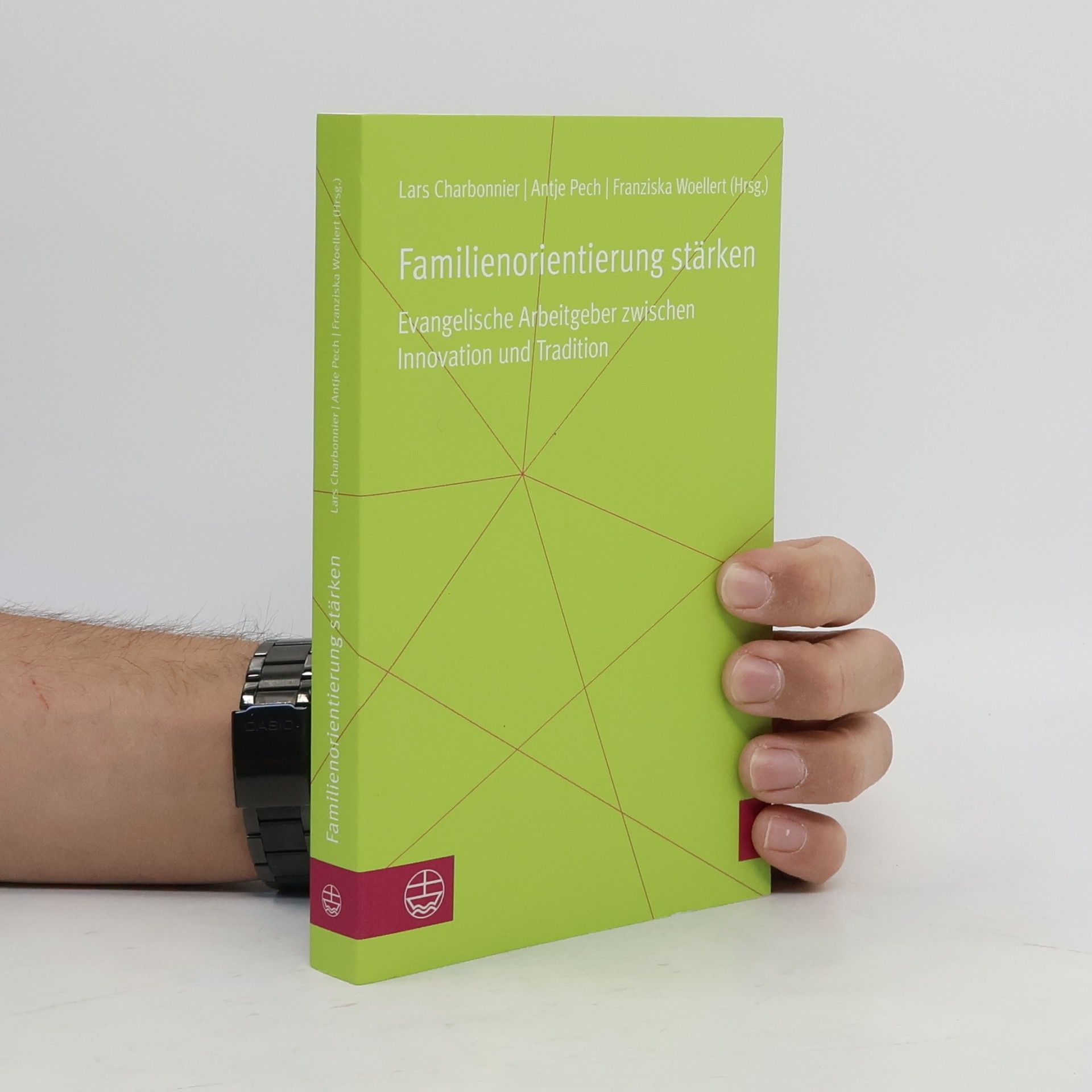Familienorientierung stärken
Evangelische Arbeitgeber zwischen Innovation und Tradition
Wir leben in einer Zeit mit weitreichenden gesellschaftlichen Veränderungen. In der Arbeitswelt 4.0 werden lange wirksame Glaubenssätze von Führung und Organisationskultur, von Beruf und Karriere, vom Wert der Arbeit und ihrem Sinn infrage gestellt. Auch die Kirche muss sich den Veränderungen stellen, die aus der wachsenden Komplexität ihrer nicht nur rechtlichen Rahmenbedingungen sowie angesichts schrumpfender Mitglieder und schwindender Ressourcen resultieren. Dabei sollte Kirche - und mit ihr die Diakonie - aus ihrem Selbstverständnis heraus sichtbar und hörbar sein, wenn es darum geht, den gesellschaftlichen Wandel aktiv zu gestalten. Vorbilder schaffen, Werte leben und Veränderung gestalten - dies sind auch wesentliche Aspekte für das evangelische Gütesiegel Familienorientierung. Familienorientierte Personalpolitik hat sich als zentraler Ansatzpunkt zur Förderung einer zeitgemäßen Organisations- und Führungskultur bewährt. Diese Publikation gibt Einblick in aktuelle Entwicklungen und erste Erfahrungen im Umgang mit diesen Ansprüchen. Mit Beiträgen von Regina Ahrens, Lars Charbonnier, Cornelia Coenen-Marx, Ute Gerdom, Bettina Hollstein, Margrit Klatte, Ulrich Lilie, Maria Loheide, Antje Pech, Gert Pickel, Steffen Schramm, Kathrin Wallrabe und Franziska Woellert.