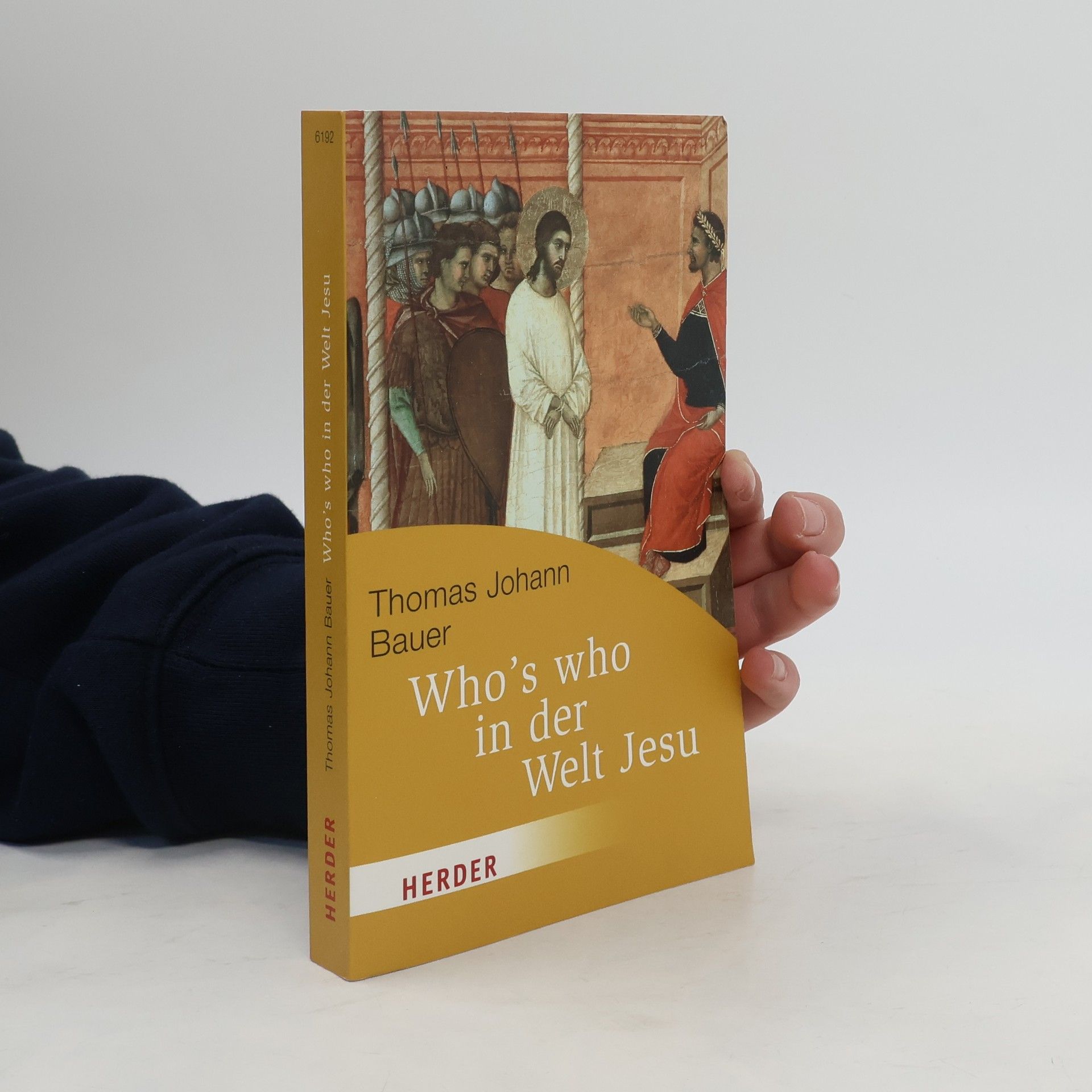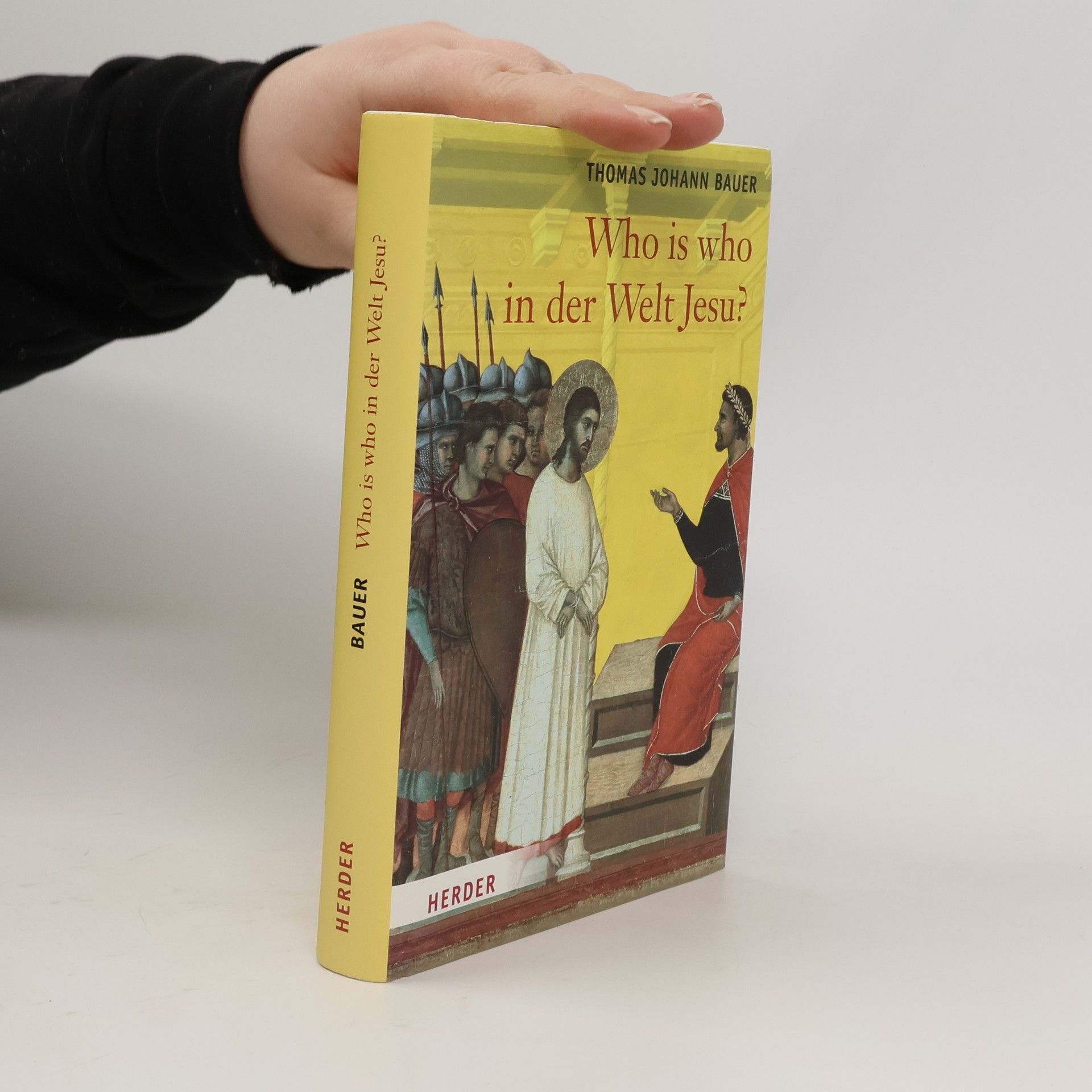Who Is Who in der Welt Jesu?
- 271 Seiten
- 10 Lesestunden
Thomas Johann Bauer beleuchtet in diesem biographischen Lesebuch die Lebens- und Wirkungsgeschichten wichtiger Persönlichkeiten des ersten Jahrhunderts nach Christus und bietet Einblicke in den historischen, kulturellen und religiösen Kontext, in dem das Christentum entstand.