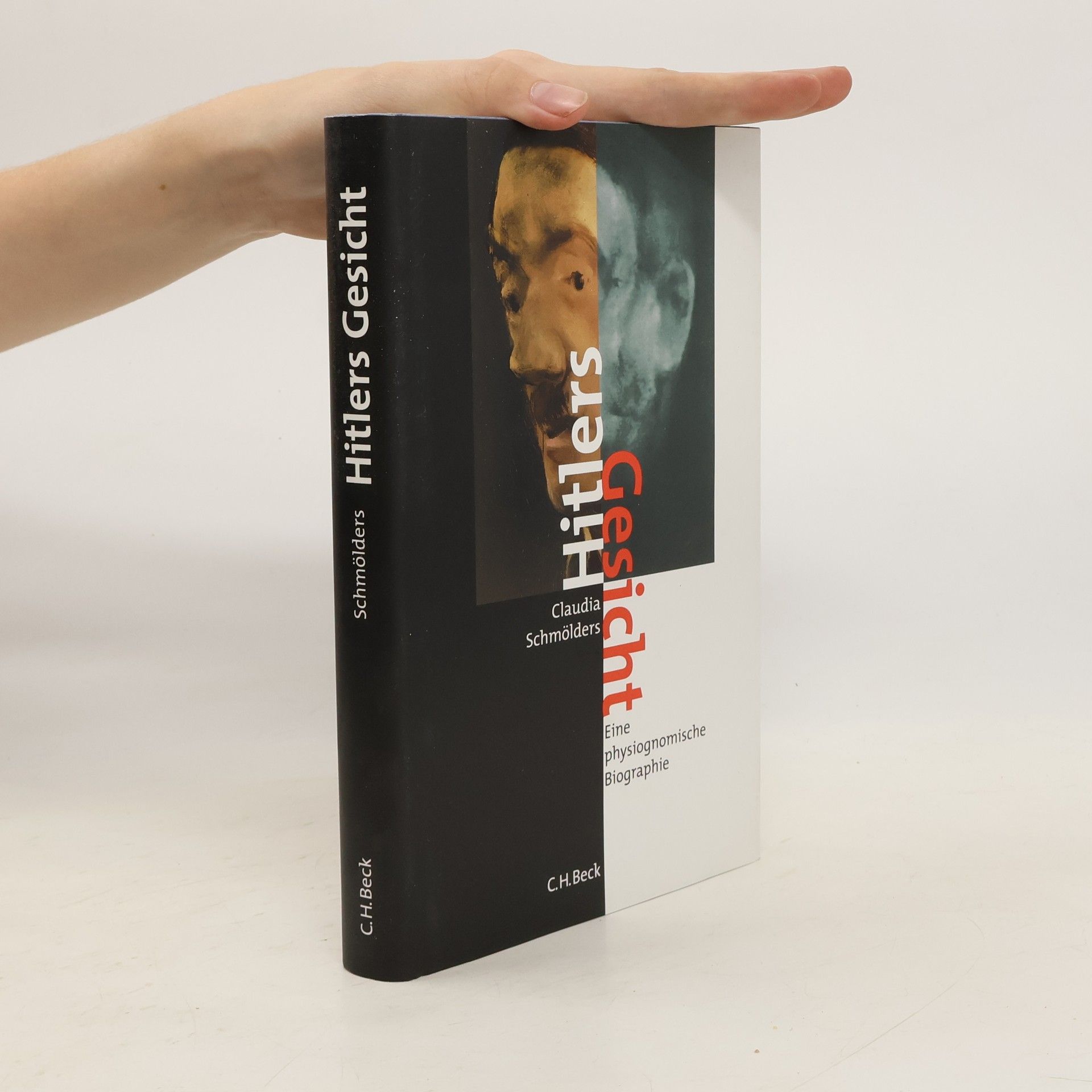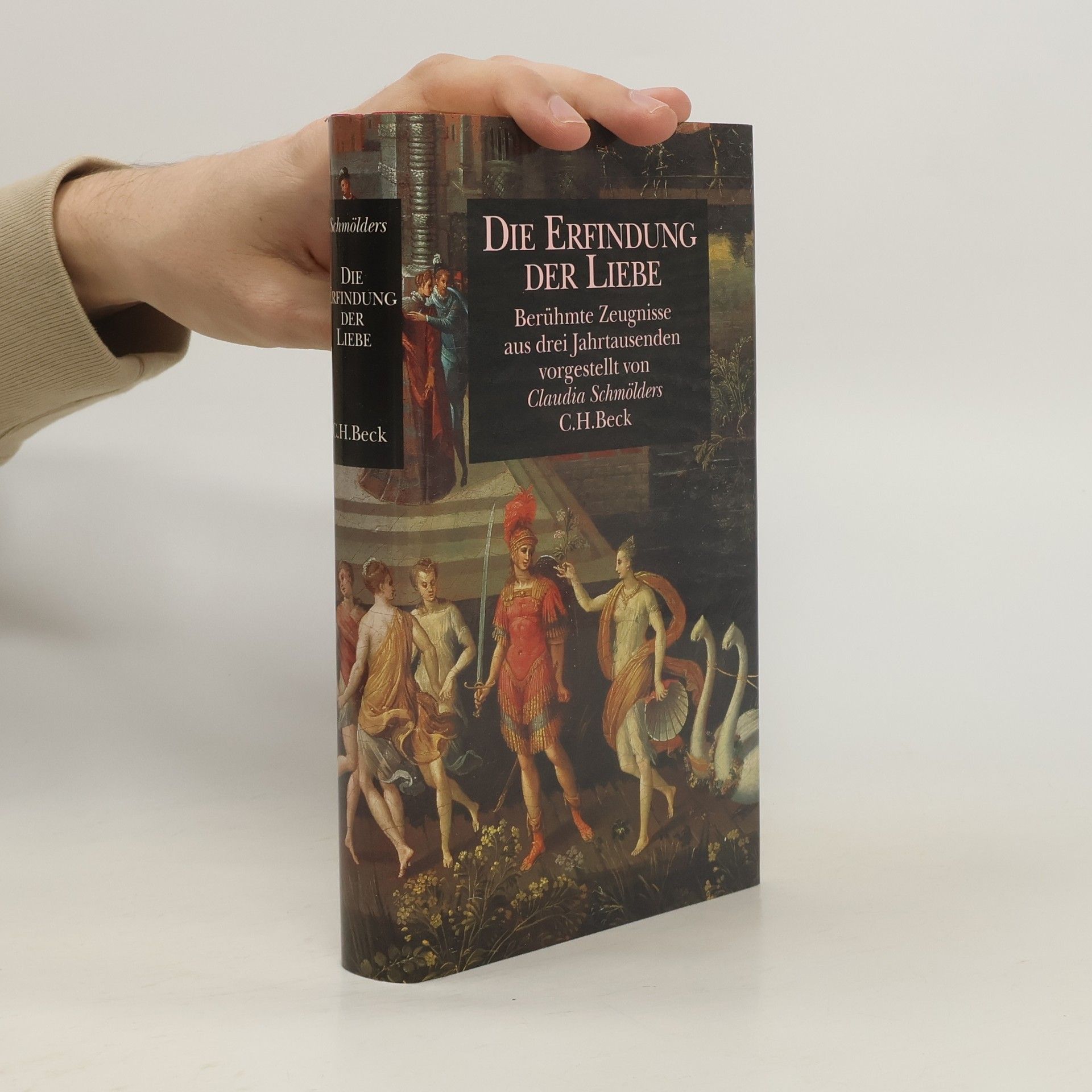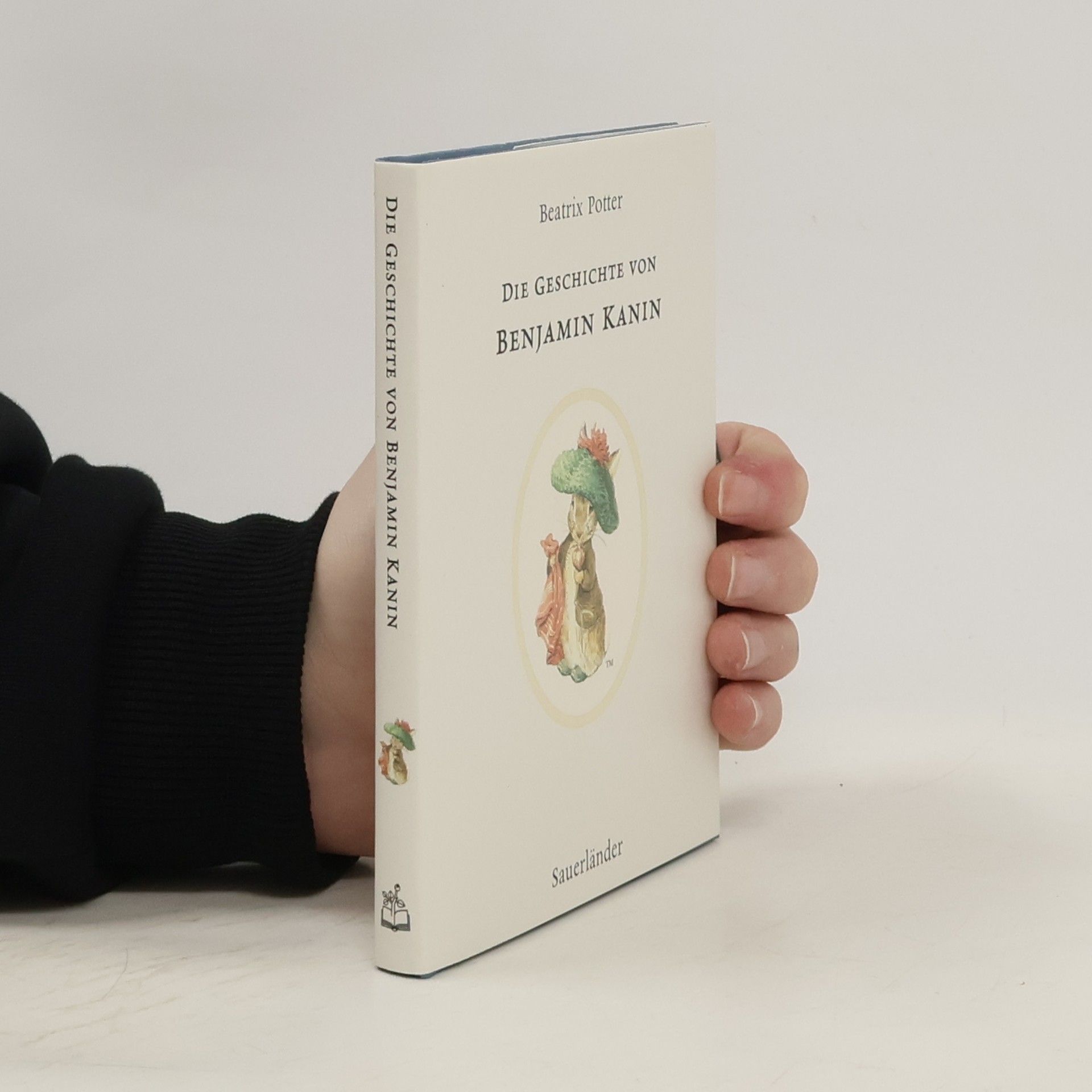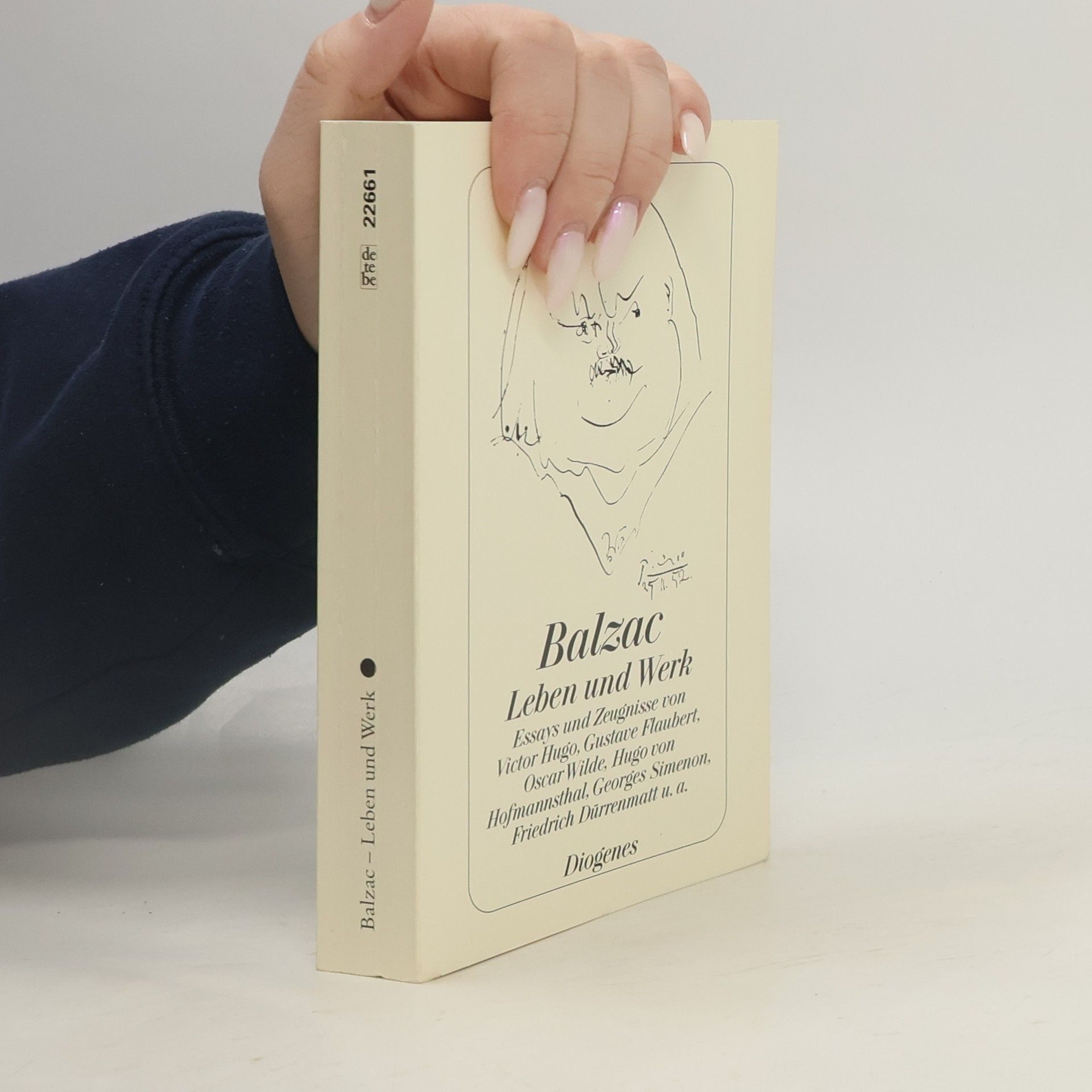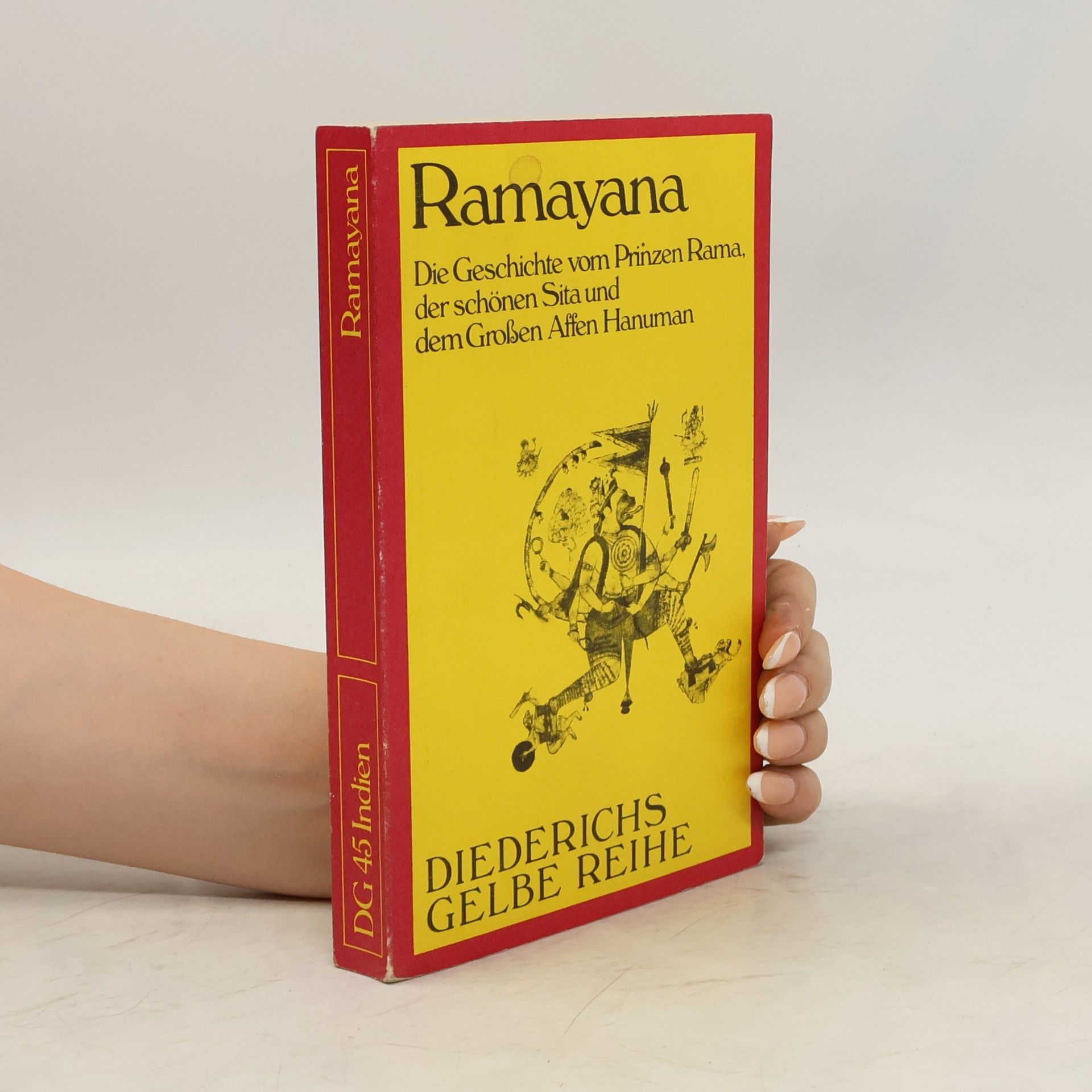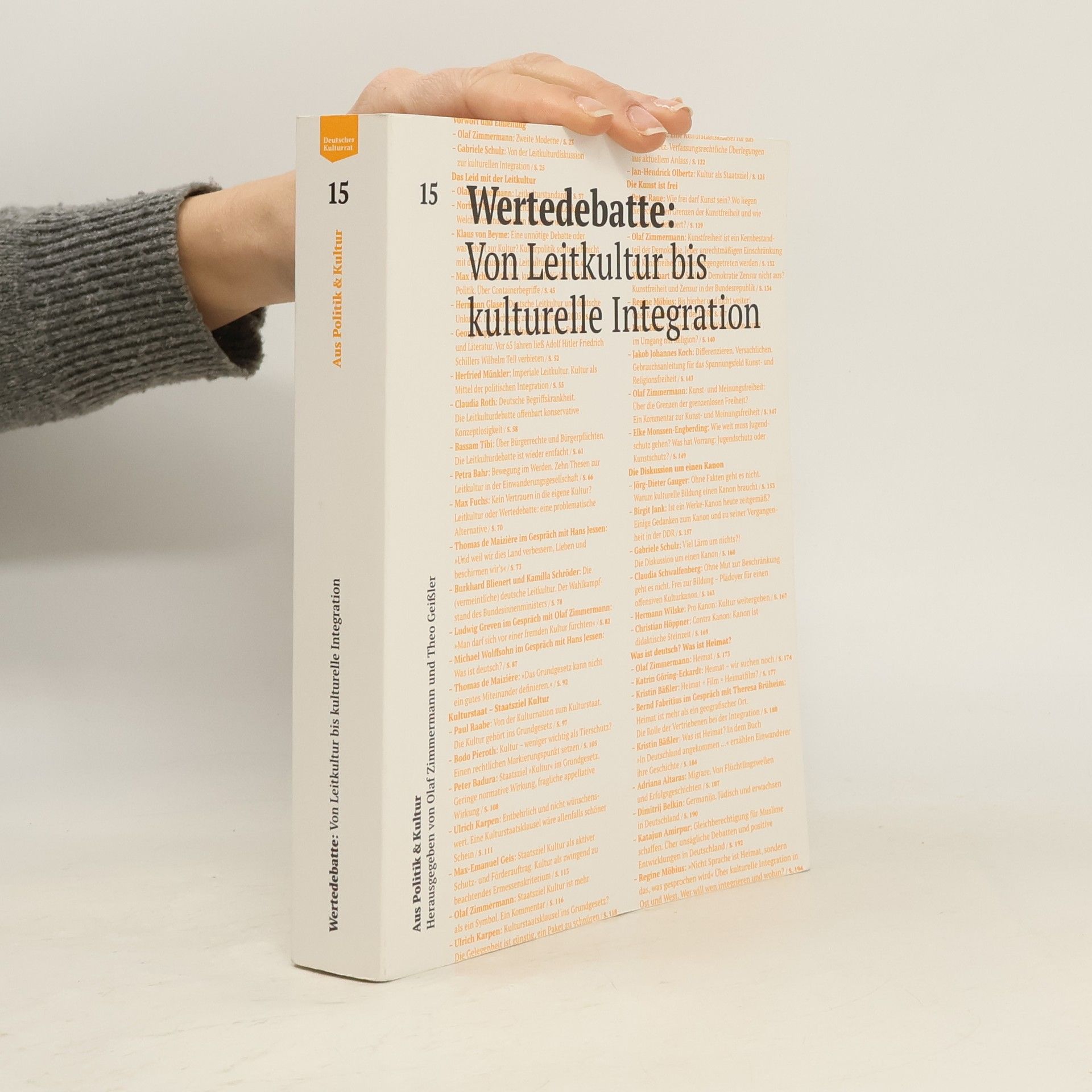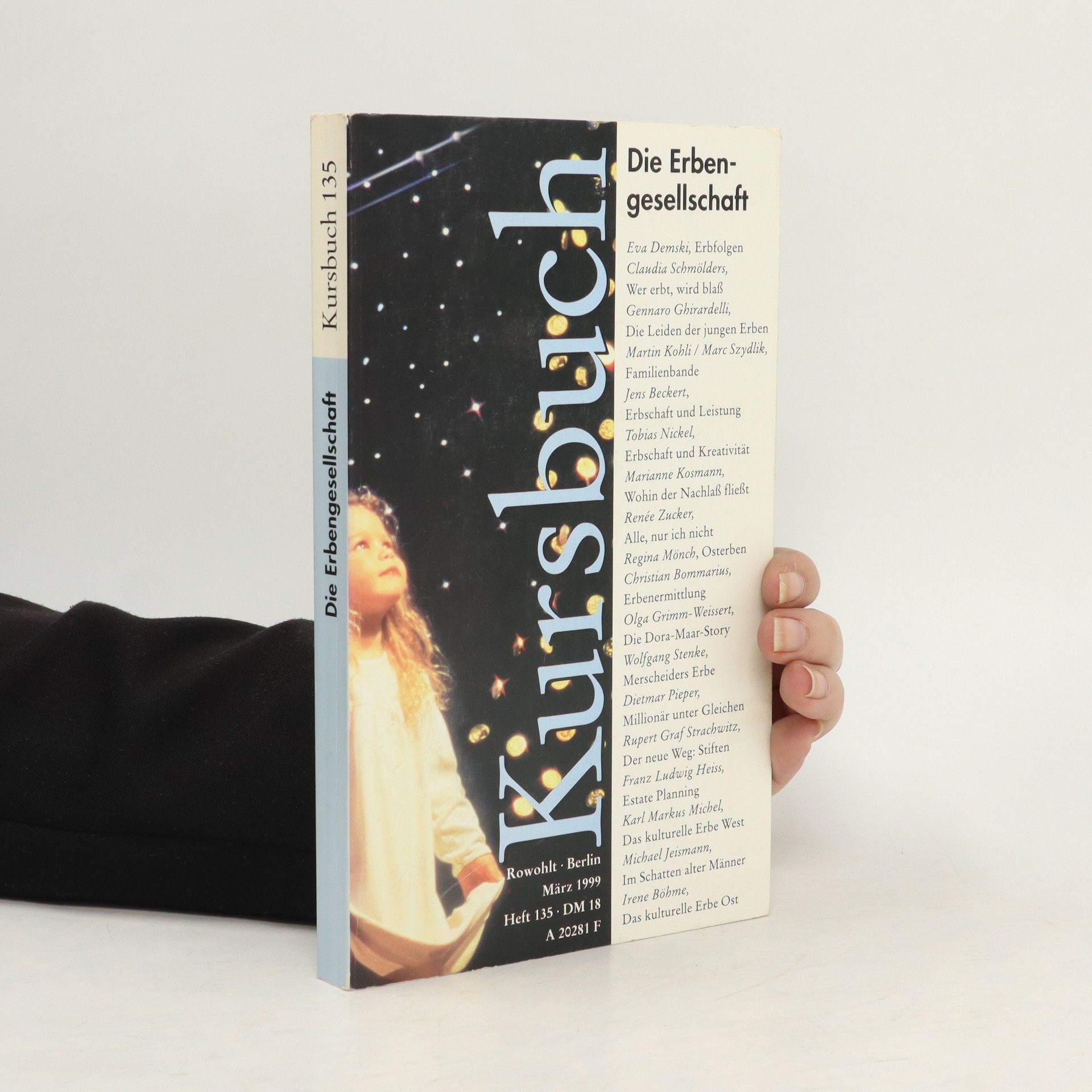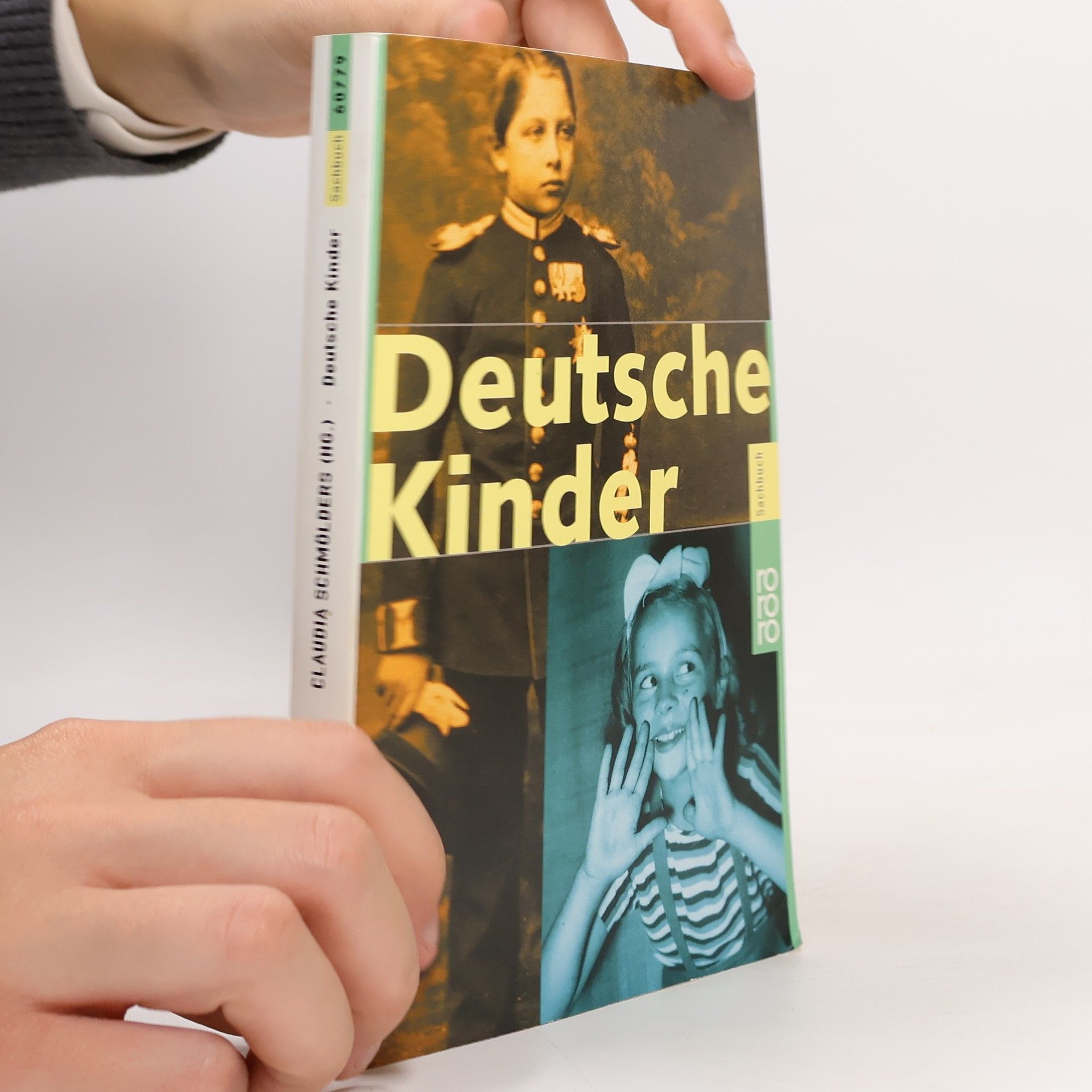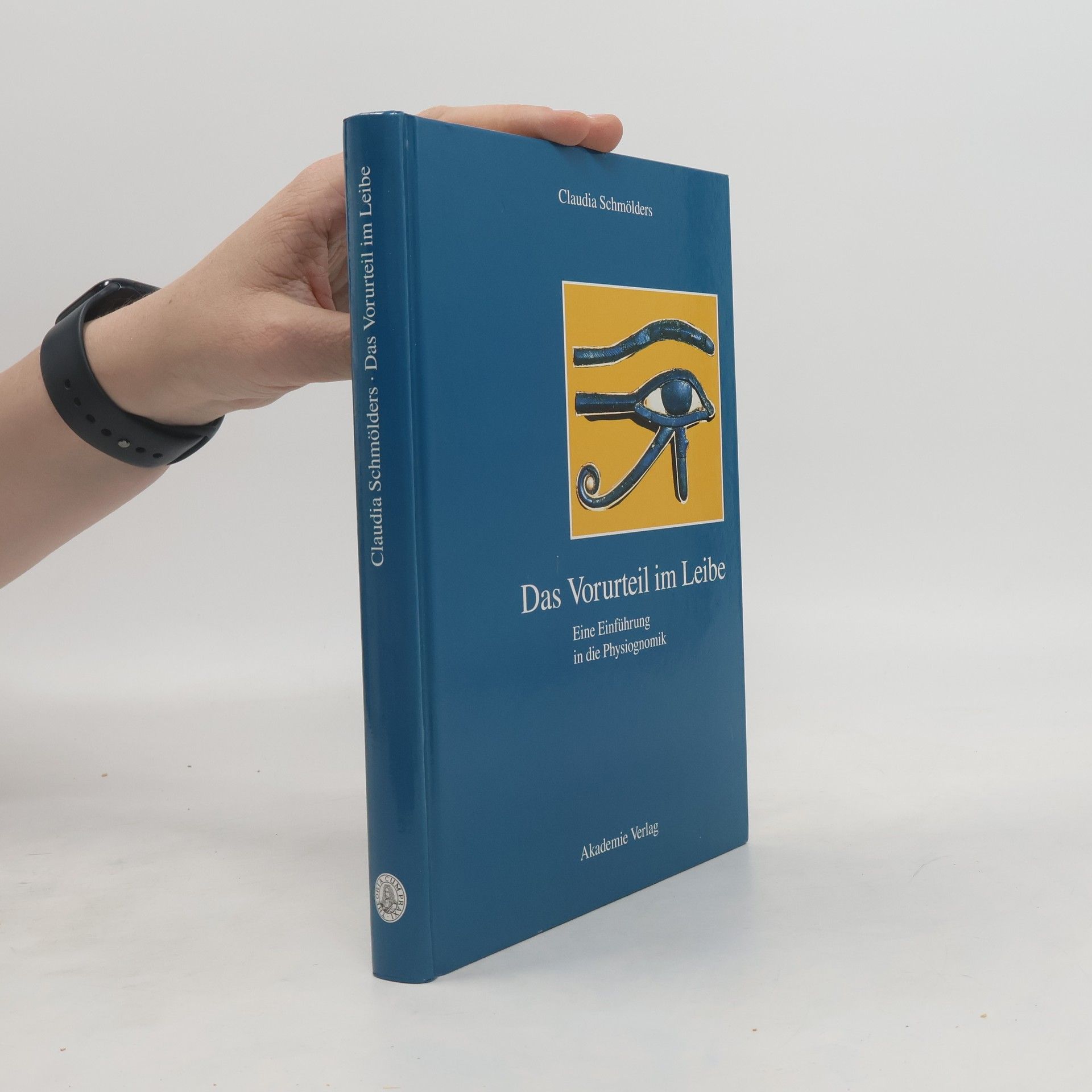Aus Politik & Kultur - 15: Wertedebatte
Von Leitkultur bis kulturelle Integration
- 548 Seiten
- 20 Lesestunden
Die Debatte um die Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten und auf die sich die Mehrheit der in Deutschland Lebenden beziehen, gleicht einer Fieberkurve. Mal geht die Temperatur hoch, hitzig, fieberhaft wird diskutiert, gestritten, polemisiert, was erlaubt ist, was in Deutschland üblich ist, wer was tun muss, um dazugehören, wie unsere Leitkultur auszusehen hat. Dann wieder sinkt die Temperatur der Debatte etwas. Es finden mehr sachliche Diskussionen statt, die sich durch ernsthaftes Nachdenken und eine kritische Reflexion auszeichnen. Die Wertedebatte gehört ohne Zweifel zu den wichtigsten Diskussionen der letzten Jahre. Die sogenannte Flüchtlingskrise hat diese Debatte noch einmal angeheizt, aber sie ist schon deutlich älter. In diesem Buch sind Beiträge aus Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates aus über zehn Jahren zusammengefasst, die viele Facetten der Fieberkurve zeigen. Es geht um die Themen Leitkultur, Werte und Tugenden, den Kulturstaat und das Staatsziel Kultur, die Kunstfreiheit, die Diskussion um einen Kanon, um die Fragen Was ist deutsch? Was ist Heimat?, um Deutschland vom Auswanderungs zum Einwanderungsland, um kulturelle Integration und Erwerbsarbeit, um kulturelle Integration als Thema der Medien und der Zivilgesellschaft, um kulturelle Integration als Aufgabe für Kultureinrichtungen und der kulturellen Bildung und die besondere Rolle der Religion in der Integrationsdebatte.