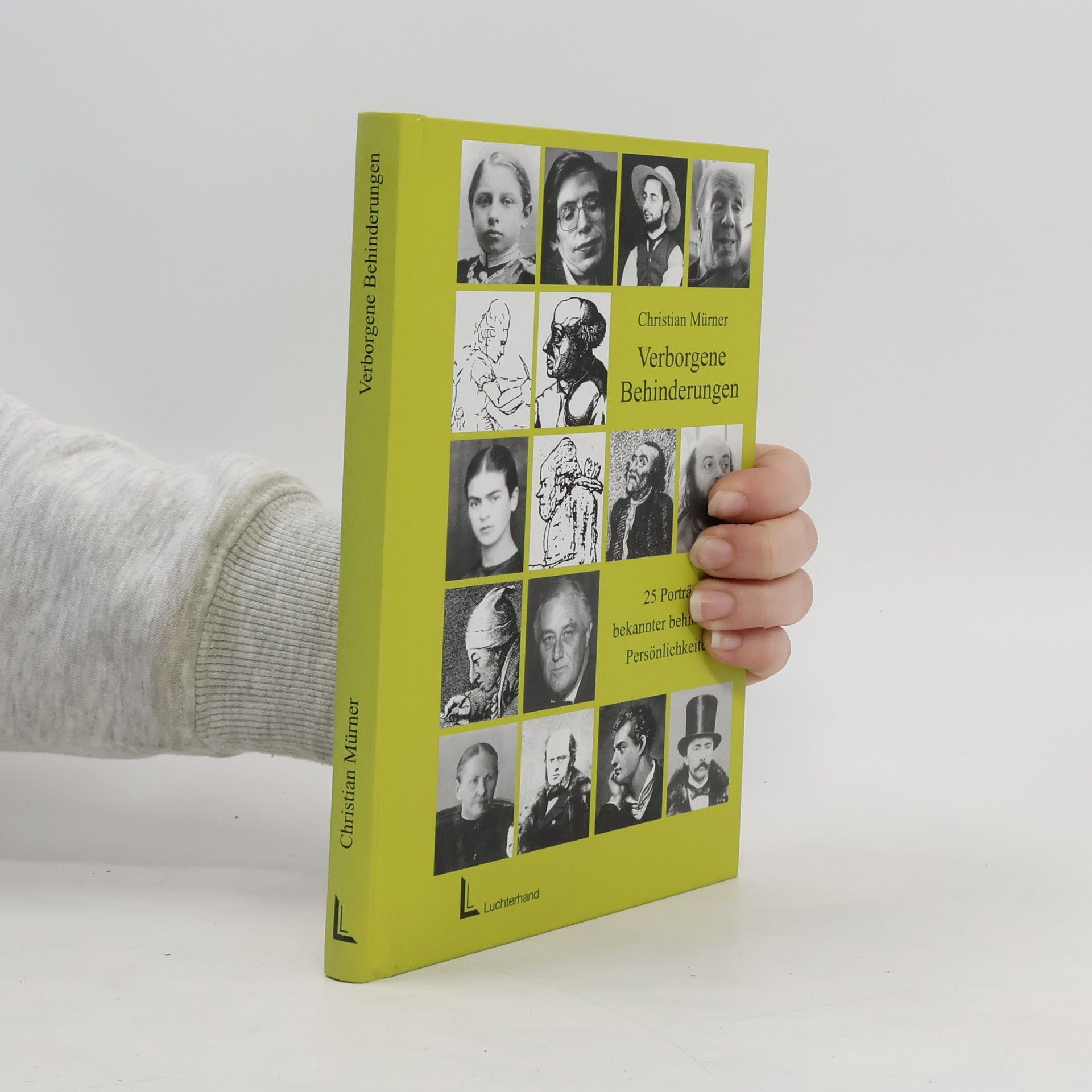Wendepunkte
im Lebenswerk von Francisco de Goya bis Frida Kahlo. Ästhetische und soziale Hintergründe. Zahlreiche farbige Abbildungen
Im Lebenswerk von Kunstschaffenden gibt es Wendepunkte. Sie erscheinen als alles entscheidend. In Biografien und Werkinterpretationen erhalten sie oft eine anregende Präsenz. Markante Zitate ziehen Aussagen zu biografischen und künstlerischen Wendepunkten heran – von Francisco de Goya über Edvard Munch sowie von Séraphine Louis bis Frida Kahlo. Die Sammlungsauswahl befasst sich mit prekären oder attraktiven Schlüsselszenen, Episoden, Anekdoten, die durch einen kurzen kulturgeschichtlichen Kontext ergänzt werden. Ist ein Wendepunkt stets ein besonderes Ereignis oder manchmal eher eine selbstverständliche Konsequenz? Aspekte zweier Beispiele: Vincent van Gogh (1853–1890): »[…] die neuen Maler, einsam und arm, werden wie die Verrückten behandelt, und infolge dieser Behandlung werden sie es tatsächlich, wenigstens was ihr soziales Leben betrifft.« Diese Stelle aus einem Brief van Goghs benennt einen Wendepunkt eines innovativen Kunstschaffenden. Bürger von Arles richteten ein Gesuch an den Bürgermeister, van Gogh zu internieren. Gertrude O’Brady (1903–1978): »Kommen Sie und schauen Sie. Ich bin Malerin geworden.« Diese Sätze von O’Brady sind ein Aufruf an die Betrachtung, ihren künstlerischen Wendepunkt wahrzunehmen. O’Brady musste wegen einer krankheitsbedingten Behandlung eine Reise in Paris unterbrechen. Hier begann sie um 1939 zu malen.