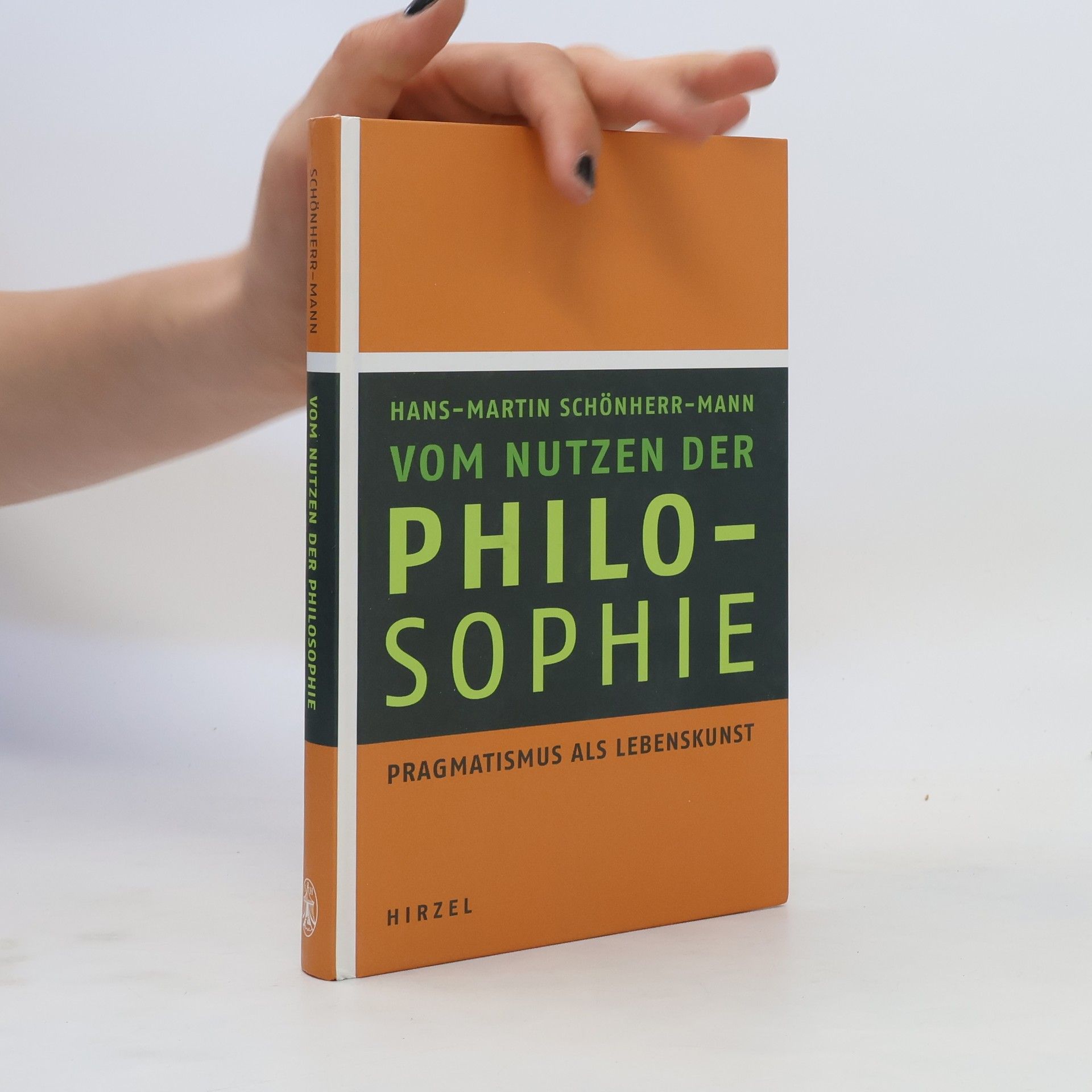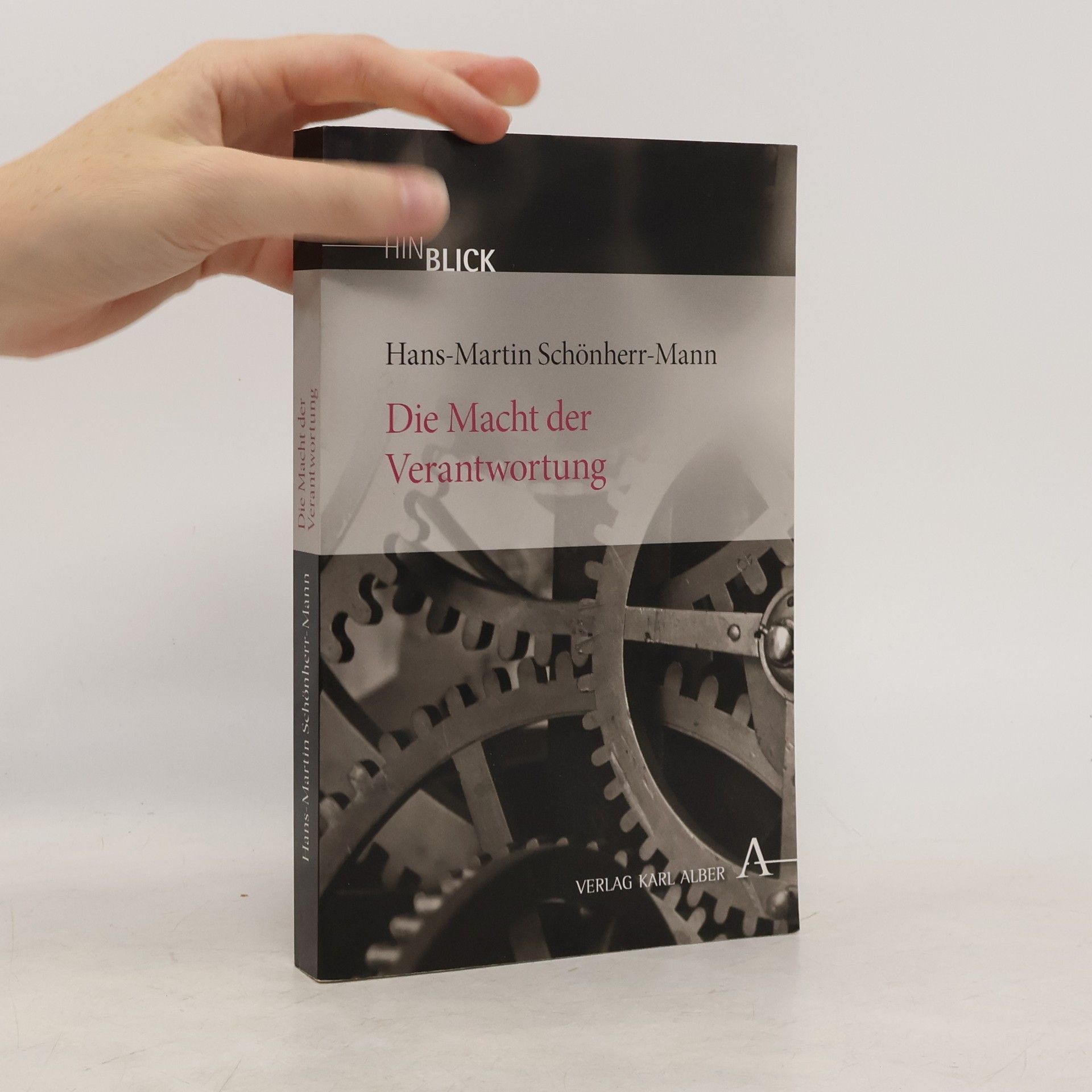Hans-Martin Lohmann Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
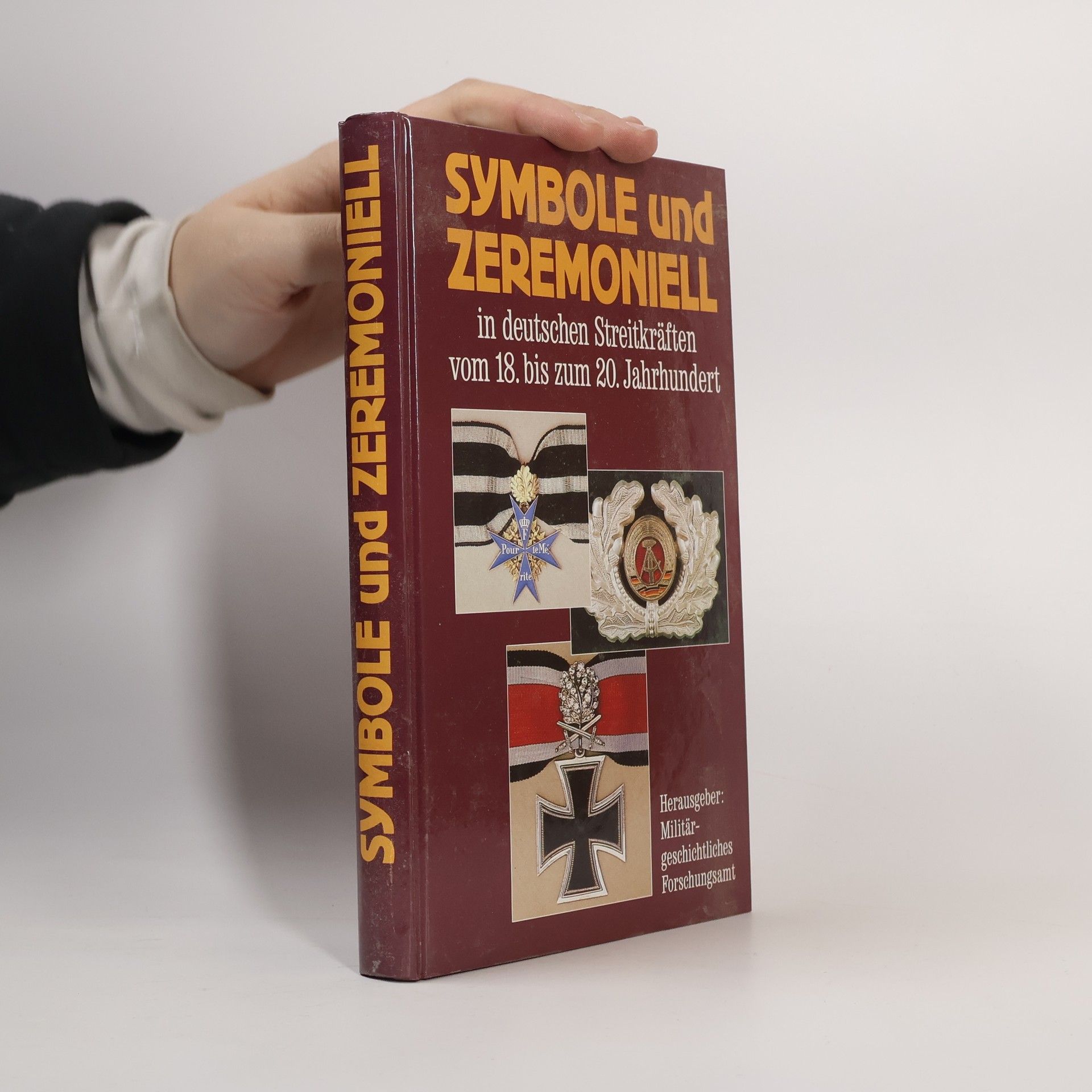
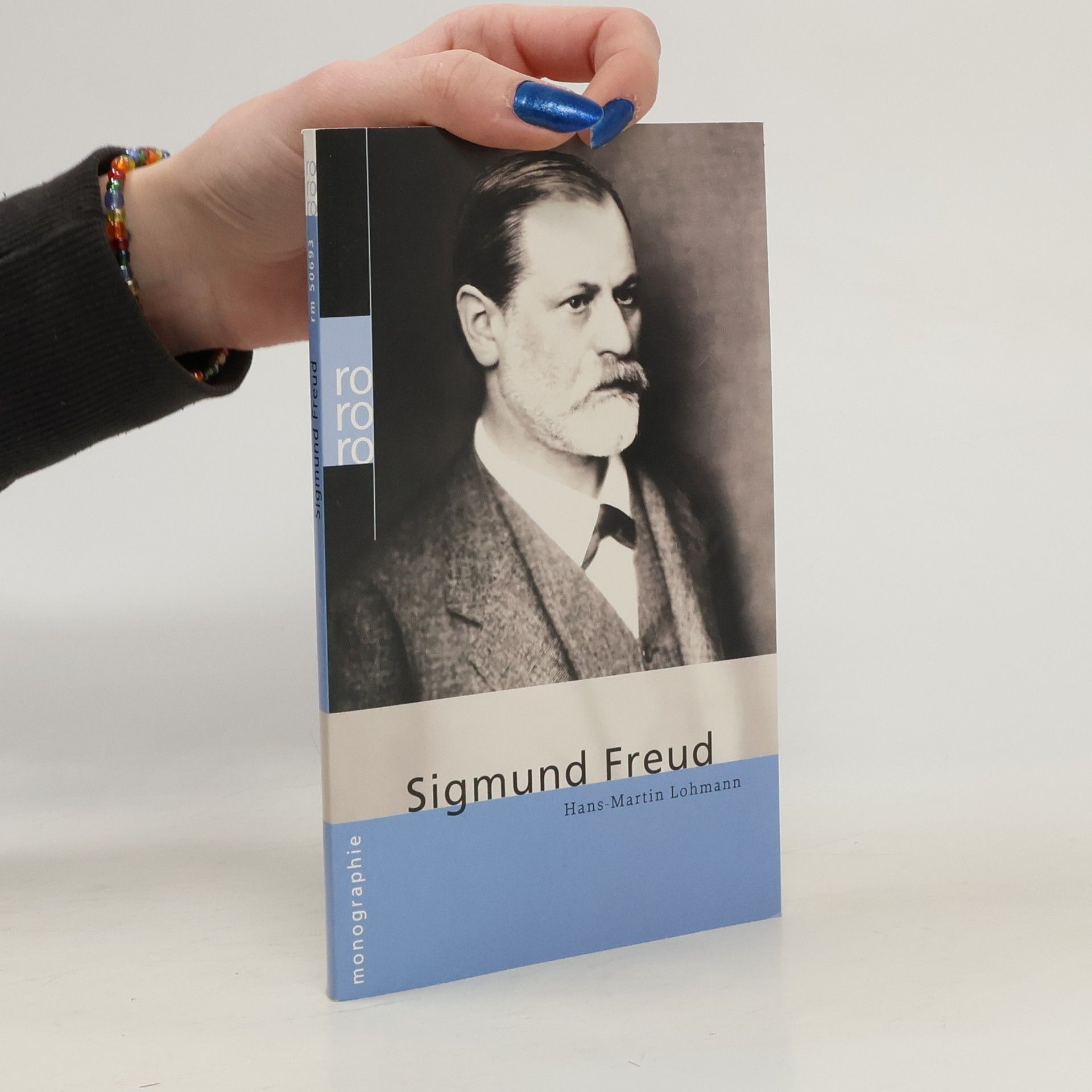


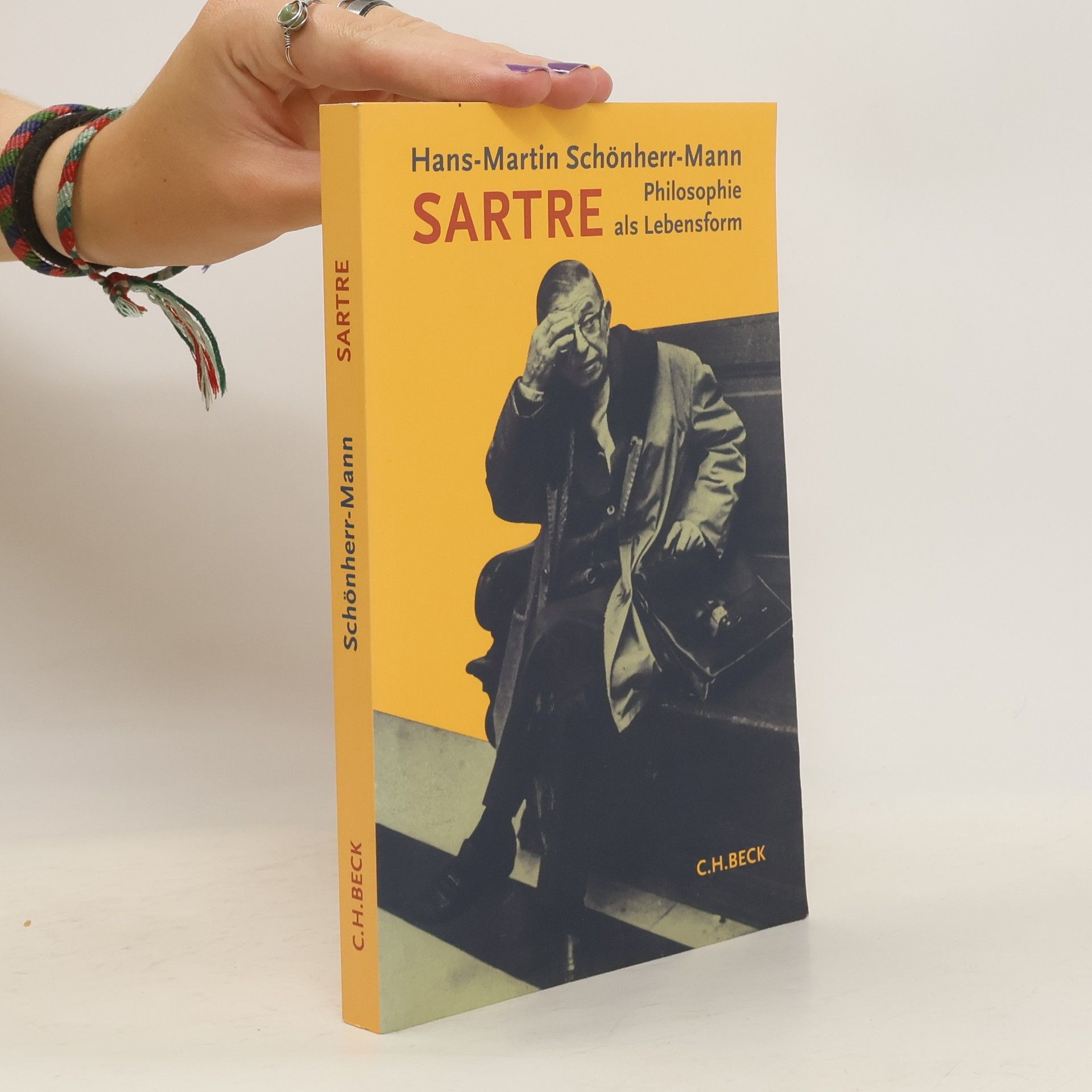
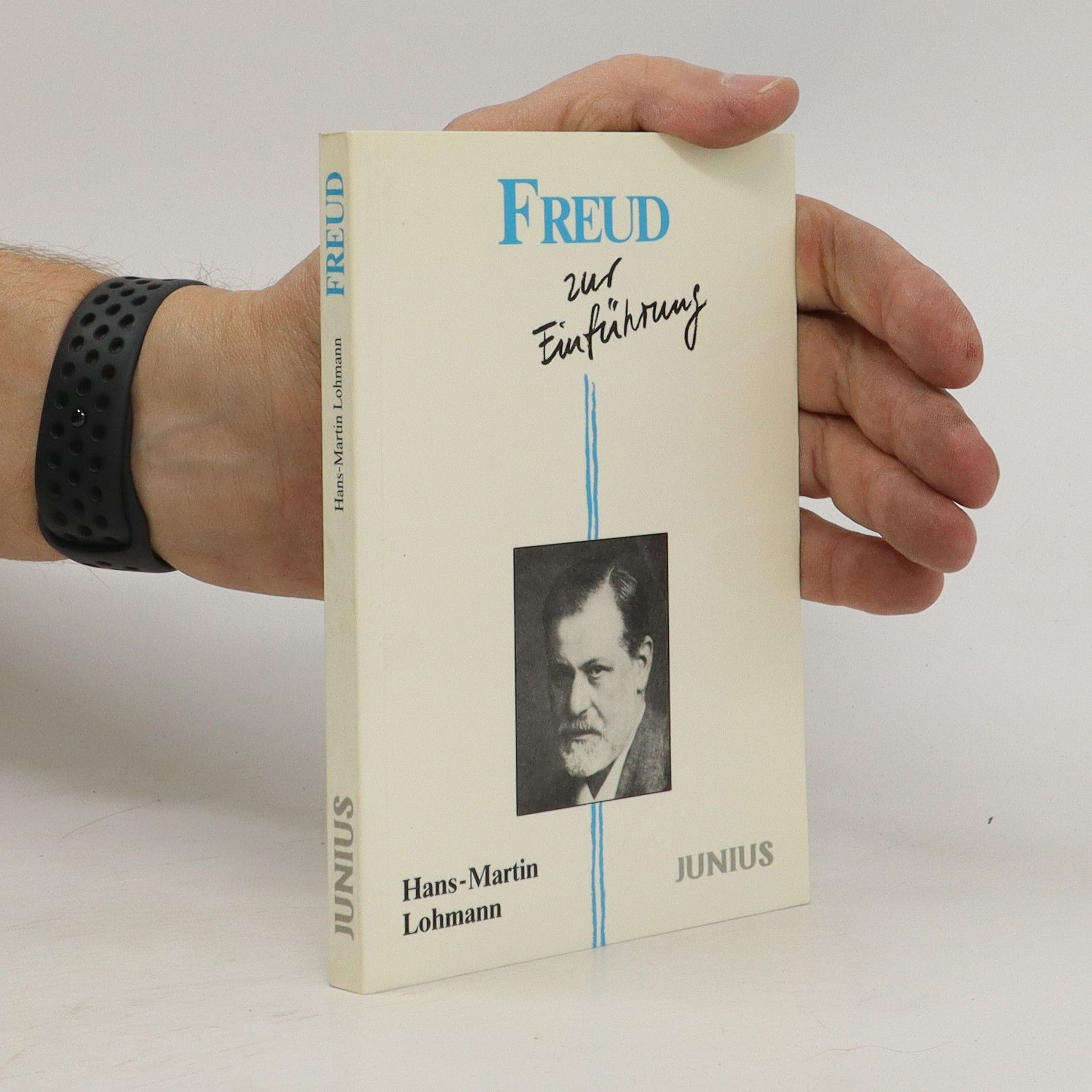
In den USA war Hannah Arendt seit 1960 eine führende öffentliche Intellektuelle. Dass sich Macht nicht der Gewalt, sondern der Zustimmung der Bürger: innen verdankt; dass der Sinn von Politik die individuelle Freiheit ist; dass Gehorsam keine Tugend ist, die von der eigenen Verantwortung befreit: Das alles wird seinerzeit heiß diskutiert. In Deutschland dagegen übergeht man ihr Plädoyer für eine partizipatorische Demokratie, man will nicht wissen, ob sie politisch links oder rechts steht, sondern sieht sich allenfalls gezwungen, sie als verfolgte Jüdin in Ehren zu halten. Erst Jahrzehnte später gewinnen ihre Ausführungen über Pluralität und Vielstimmigkeit hierzulande an Resonanz, auch aufgrund ihrer eigenständigen Denkweise und ihrer Forderung nach freier politischer Diskussion. Hannah Arendt gilt heute als eine der bedeutendsten Philosophinnen des 20. Jahrhunderts. Das Porträt zeichnet ihr spannendes Leben nach und führt grundlegend in ihr Denken ein.
Was hat pragmatisches Denken mit Philosophie zu tun? Durch Ethik, Ästhetik, Sozialphilosophie und andere philosophische Themenbereiche kann man sehr viel gewinnen, gerade im Alltag. Hans-Martin Schönherr-Mann führt aus, wie sich durch Philosophie in Form des Pragmatismus das moderne Leben leichter bewältigen lässt. Dieser philosophisch inspirierte Pragmatismus soll zu einer Lebenskunst beitragen, ohne dass man sich dabei in höhere philosophische Gefilde verirrt; er soll aber auch verhindern, dass man in kitschige Banalitäten abrutscht, indem man einfach schöner leben möchte.
Philosophie der Liebe
- 221 Seiten
- 8 Lesestunden
Eine Apologie des Rauschhaften und Abgründigen als Individuationsprinzip schlechthin, durch das der Mensch sich jedem Verwertungszusammenhang entzieht und von einem gesellschaftlichen Nicht-Ort aus zu sich selbst kommt. Ein aphoristischer Essay, von beeindruckender Wissensfülle, über den Zusammenhang von Lust und Reue.
Die Macht der Verantwortung
- 224 Seiten
- 8 Lesestunden
Ethisches Handeln, das der Einzelne verantworten will, kann scheitern, auch wenn gute Gründe gegen eine Handlung sprechen. Welche Tugenden und Kompetenzen sind notwendig, um Verantwortung gerecht zu werden? Verantwortung ist ein relativ neues Thema in der Ethik, das sich im 20. Jahrhundert entwickelte. Max Weber sprach 1919 erstmals von Verantwortungsethik, die nicht nur ethische Normen, sondern auch deren Folgen in den Fokus rückt. Dies führt zu einem Streit zwischen Verantwortungs- und Normenethik, der bis heute anhält. Relativiert die Verantwortungsethik ethische Normen und stellt sie einen Wertezerfall dar? Oder sucht sie ein neues ethisches Fundament in einer pluralistischen Welt mit konkurrierenden Systemen? Bei einer verantwortungsethischen Orientierung an Normen stellt sich die Frage nach deren Geltung und Anwendung. Das Tötungsverbot gilt als universell, wird jedoch oft nicht beachtet, sei es durch Ideologien, Umwelteinflüsse oder Institutionen, die Verantwortung abnehmen. Hans-Martin Schönherr-Mann führt in die Grundmodelle der Verantwortungsethik von Weber, Sartre, Lévinas und Jonas ein, wobei die Reichweite der Verantwortung für überschaubare Folgen, die Situation, den Anderen oder die Zukunft der Menschheit thematisiert wird.
Simone de Beauvoir und das andere Geschlecht
- 238 Seiten
- 9 Lesestunden
Mit ihrer Kritik am traditionellen Frauenbild hat Simone de Beauvoir Denken und Leben zahlreicher Frauen verändert. Im Mittelpunkt dieser Einführung in Leben und Werk steht ihr berühmtestes Buch, Das andere Geschlecht, über die Lage der Frauen in der westlichen Welt. Sie kam zu dem Schluss, dass die engen Grenzen des »Typisch Weiblichen« von der Gesellschaft bestimmt sind, und fasste dies in der damals sehr provokanten These zusammen, dass man nicht zur Frau geboren, sondern zur Frau gemacht wird. Sie lehnte weder die Liebe noch die Familie ab. Was sie forderte, war: Die Menschen sollten nicht alleine aufgrund ihres Geschlechts in Zwangslagen geraten, aus denen sie sich nicht mehr befreien können.
Freud-Handbuch
- 452 Seiten
- 16 Lesestunden
Sigmund Freud - Revolutionär des alltäglichen Bewusstseins, der Sprache, der kulturellen Verhaltenscodes und der modernen Wissenschaften vom Menschen. Auch fast 70 Jahre nach seinem Tod spaltet er die Nachwelt in das Lager der glühenden Verehrer und in jenes der scharfen Kritiker. Ohne Zweifel, Freud hat nicht nur die Psychoanalyse, sondern alle geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen maßgeblich geprägt: von der Literaturwissenschaft bis zur Ethnologie. Nach dem bewährten Konzept der Metzler-Handbücher erschließen die Autoren Leben, Werk und Wirkung Sigmund Freuds. Erstmals stehen in einem Freud-Grundlagenwerk vor allem seine kulturtheoretischen Leistungen im Mittelpunkt. Eine brillante und facettenreiche Analyse.
Sartre
- 173 Seiten
- 7 Lesestunden
Jean-Paul Sartre, dessen Geburtstag sich am 21. Juni 2005 zum hundertsten Male jährt, hat durch sein Denken und sein Engagement eine ganze Epoche geprägt. Hans-Martin Schönherr-Mann stellt Sartres intellektuelle Existenz vor und führt den Leser durch Sartres Werk. Er wird dabei von der Frage geleitet, inwieweit Sartres Philosophie und Lebensform des Existenzialismus Antworten auf die aktuellen Probleme im Zeitalter der Globalisierung und Individualisierung zu geben vermag. Das Buch gibt einen Überblick über Sartres Leben und sein Werk, führt dabei vor allem in seinen Existenzialismus ein und zeigt dessen Aktualität auf: eine philosophisch durchdachte Lebensform könnte dem modernen Menschen helfen, unter unsicheren sozialen, ethischen und religiösen Umständen die eigene Existenz zu gestalten.
Auf der Spur des verlorenen Gottes
- 208 Seiten
- 8 Lesestunden