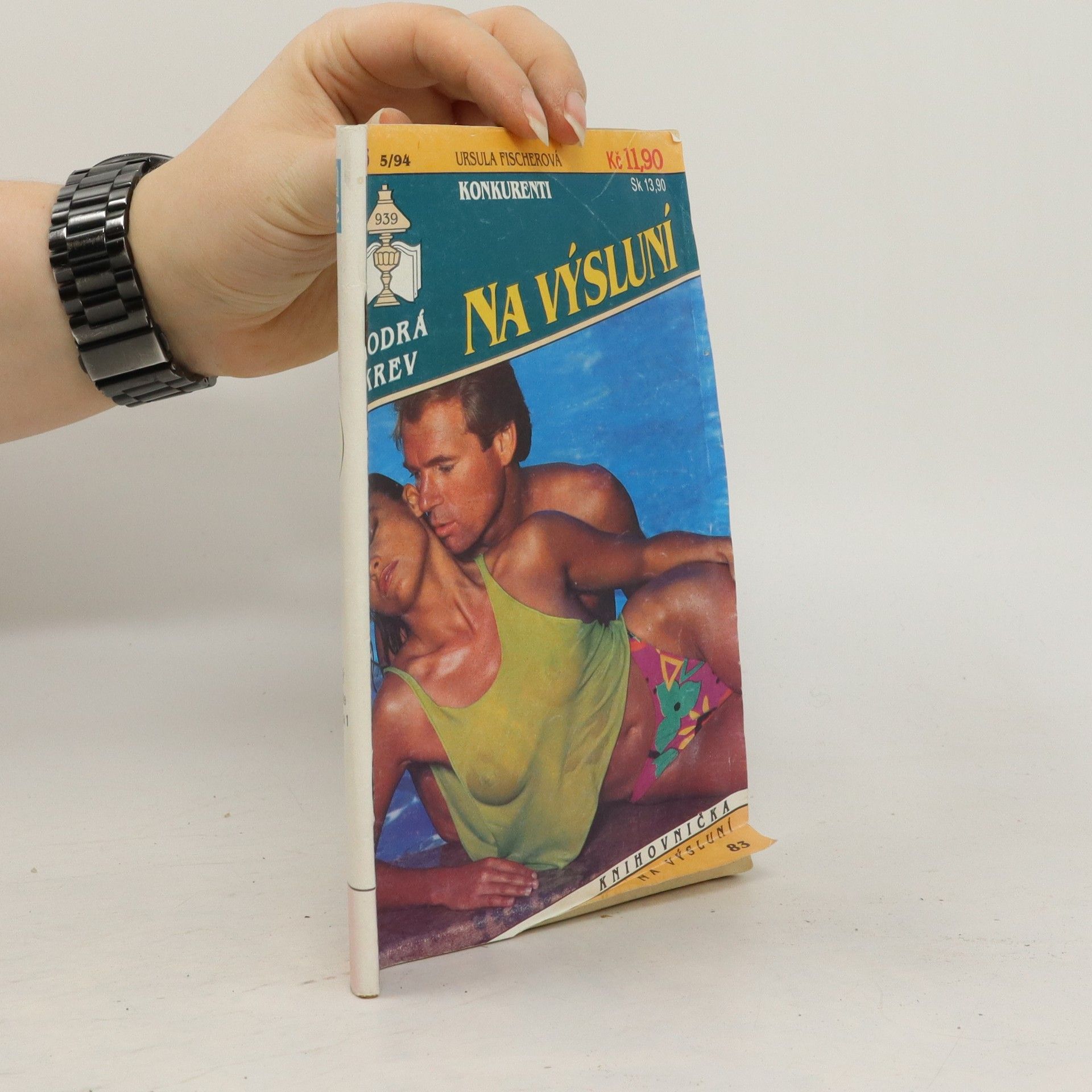Ursula Fischer-Schmidt Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
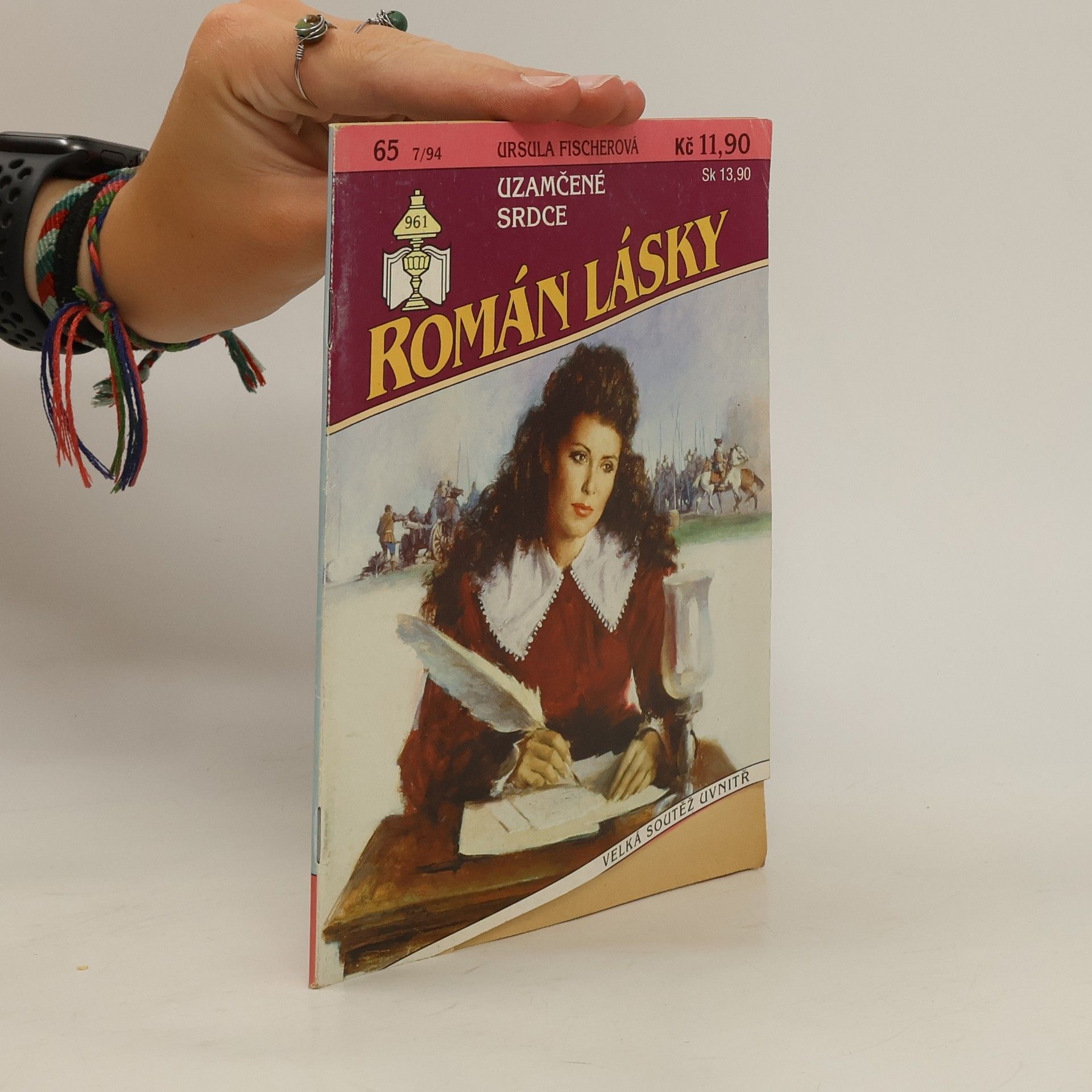
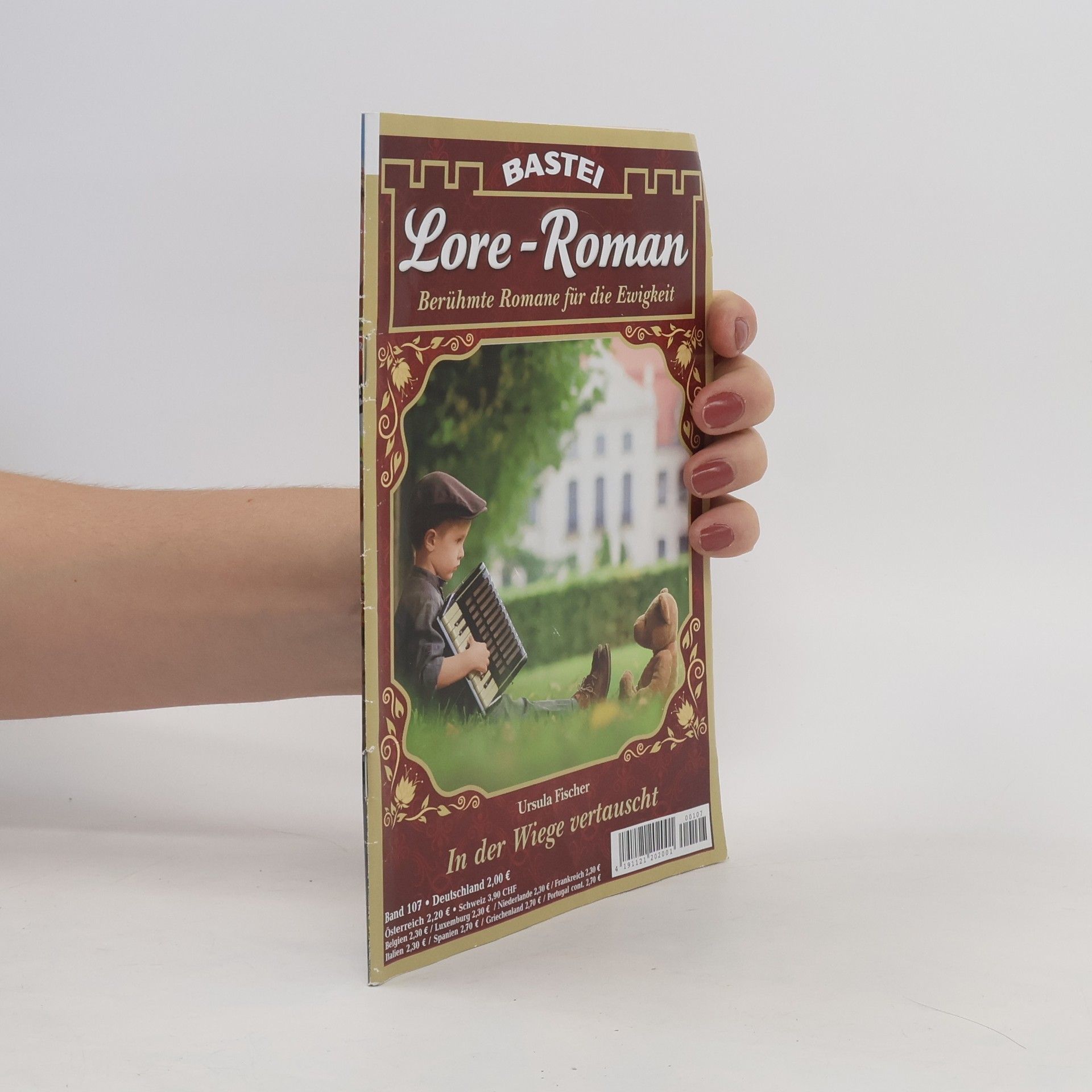
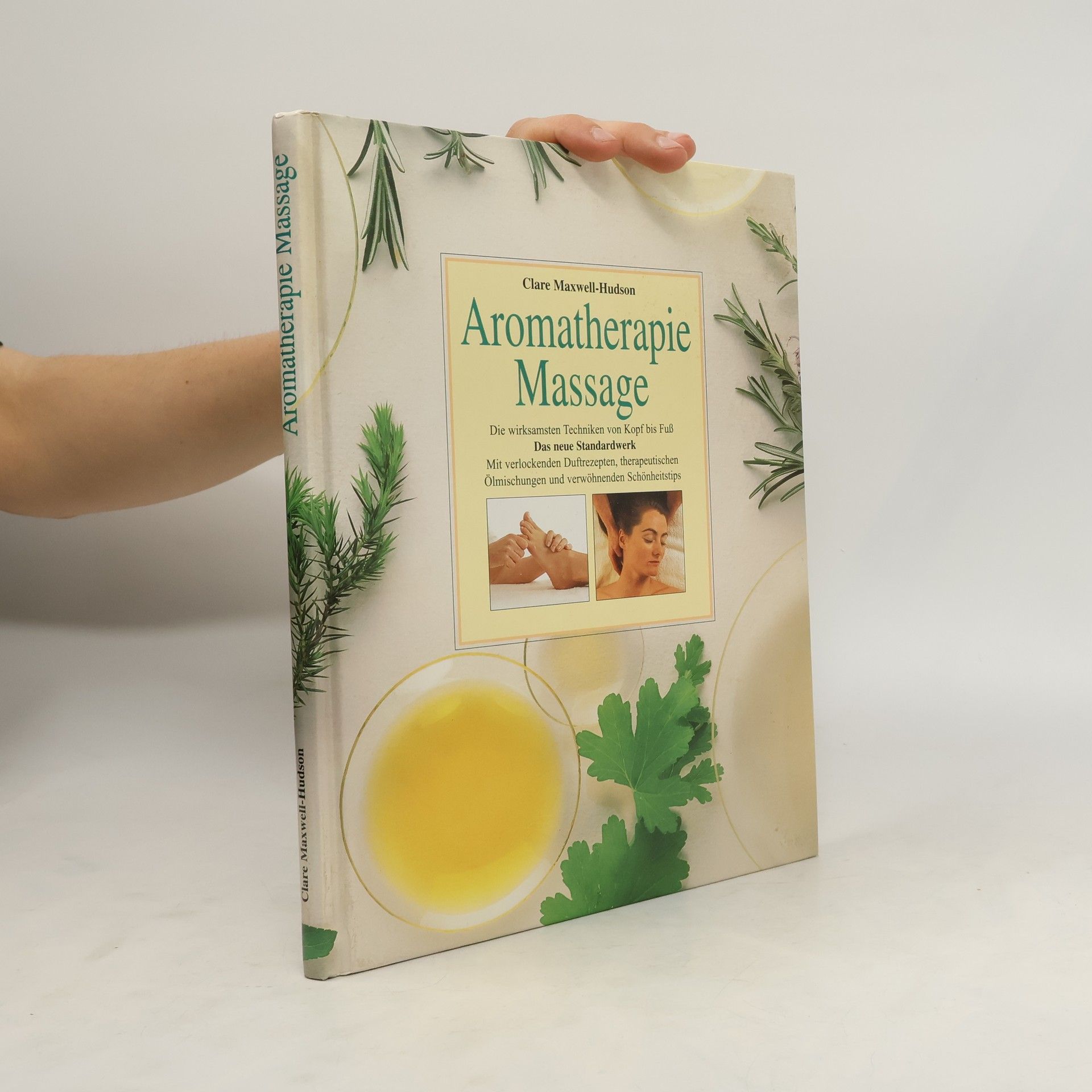


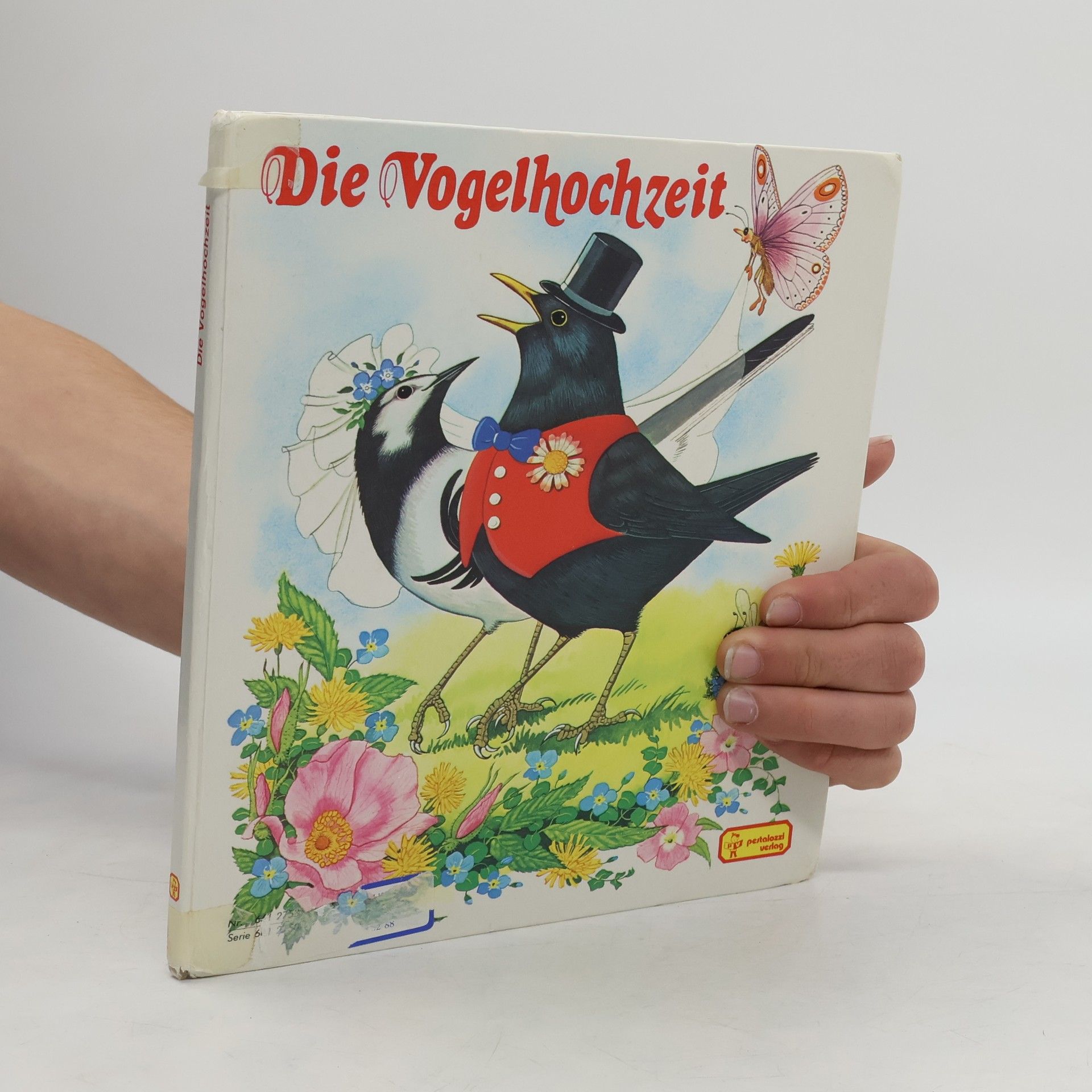
Lore-Roman 107
In der Wiege vertauscht
Těsně poté, co se půvabná Marianne rozhodne zřídit vedle své malé benzinové stanice motel, vstoupí do jejího života dva muži: majitel blízkého zámku hrabě Helmar, s nímž se dívka brzy sblíží, a jeho přítel Lothar, Mariannin netušený a záludný konkurent...
Uzamčené srdce
- 61 Seiten
- 3 Lesestunden
Říká se tomu láska
- 62 Seiten
- 3 Lesestunden
Monika po absolvování školy nastoupí jako kuchařka do hraběcí rodiny a zamiluje se do hraběte Karstena. Monika touží po sňatku, ale hrabě dáva přednost kariéře. Dívka odchází a věnuje se novému zaměstnání i výchově syna. Po letech se znova setká s Karstenem.