Der Band „Die Lehrjahre Wilhelm Meisters bei den Frauen“ versammelt Beiträge von verschiedenen Autoren, die sich mit Themen wie Wilhelms Beziehungen und Identität in Goethes Werk beschäftigen. Herausgegeben von Wilhelm Solms, reflektieren die Texte die sozialen Konflikte und die Komplexität der Liebe in Goethes Roman.
Wilhelm Solms-Rödelheim Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
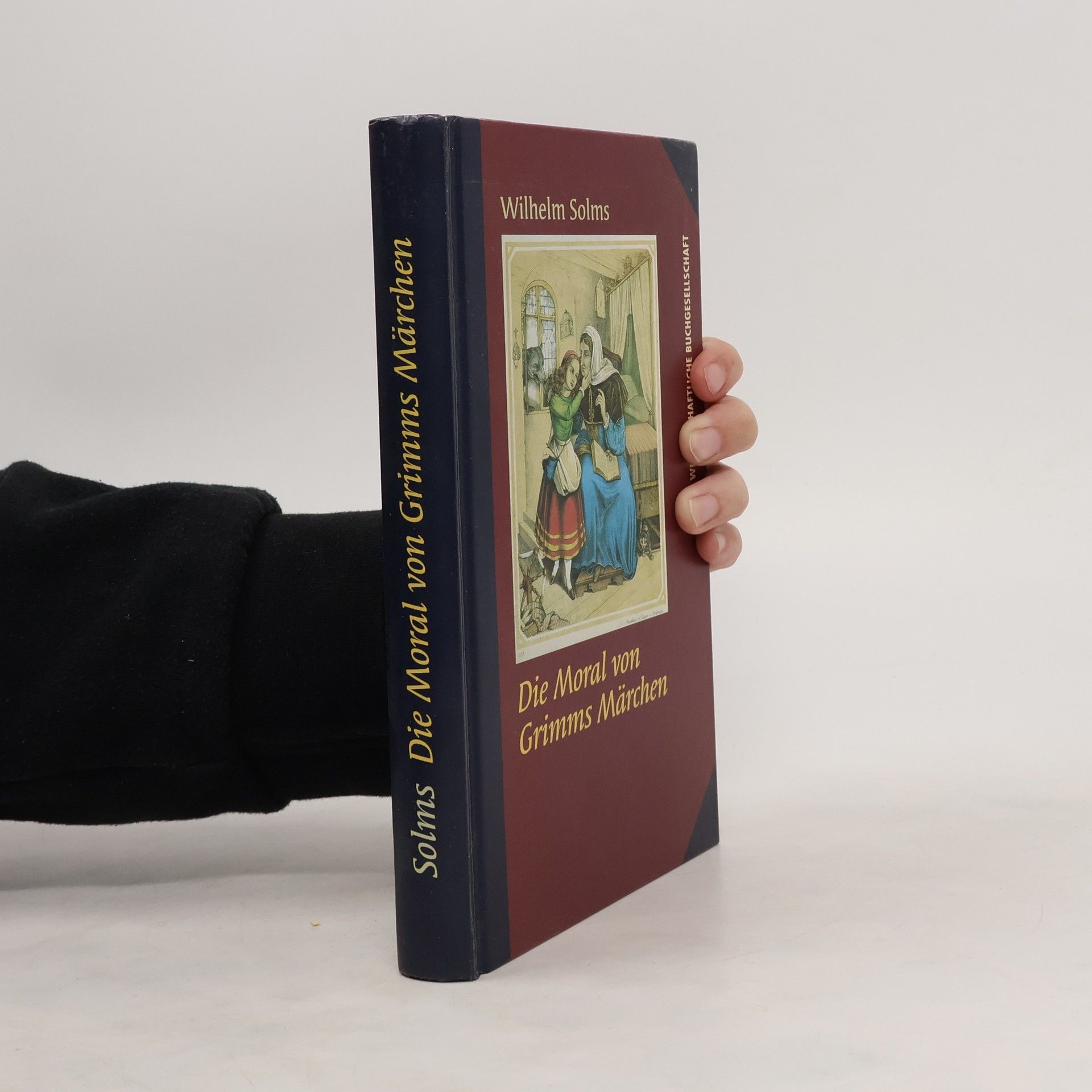
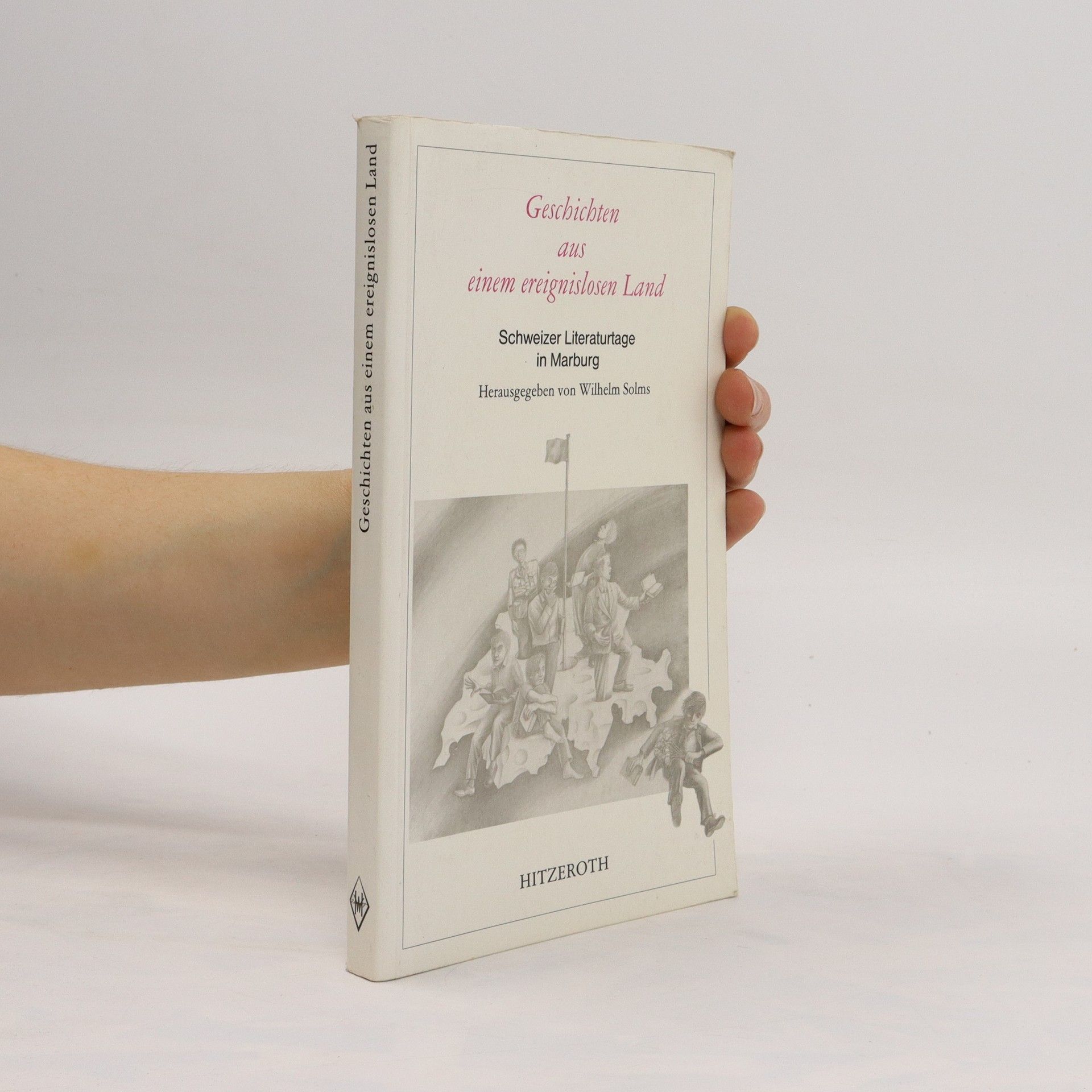

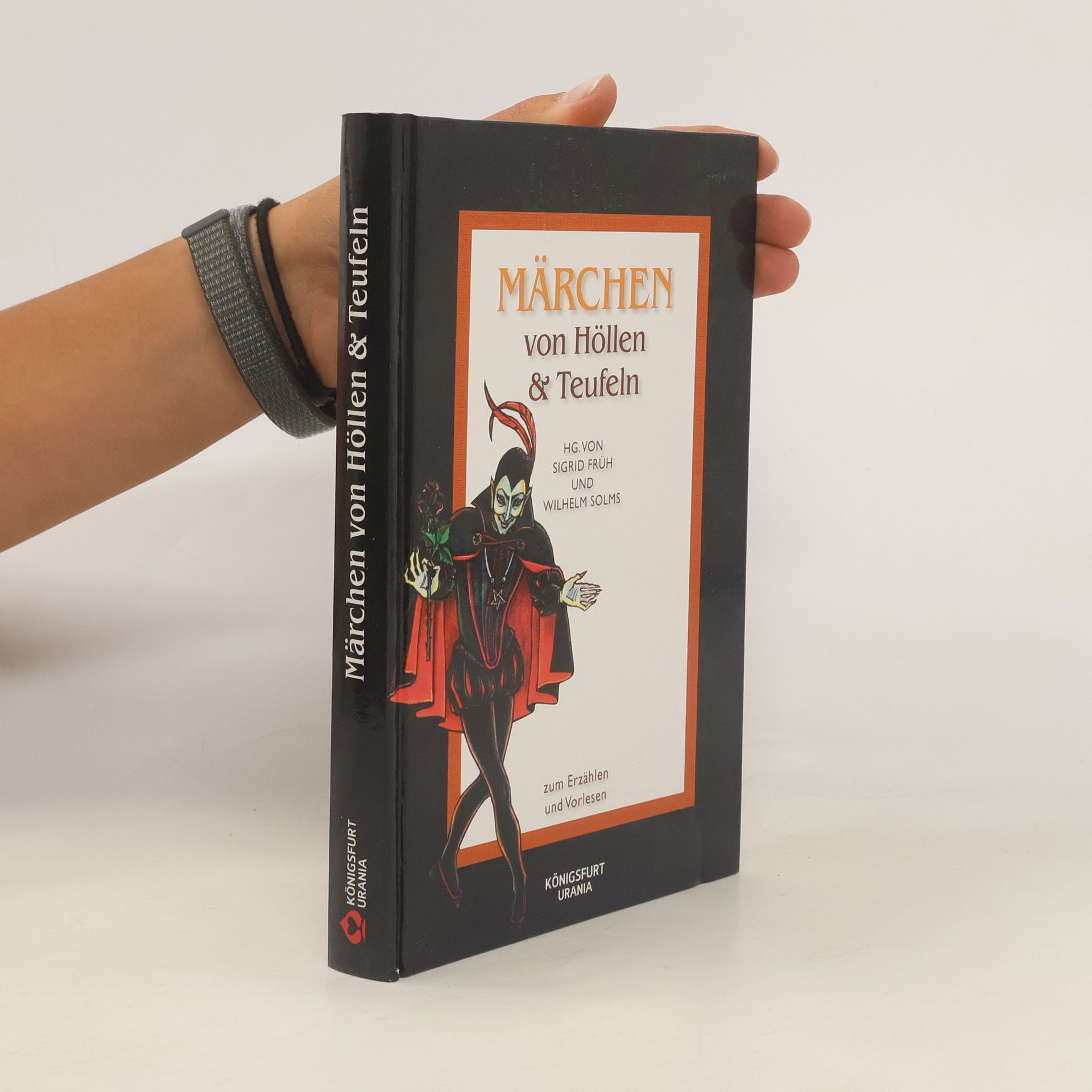
Der Teufel als Personifizierung des Bösen ist eine uralte Figur im Volksmärchen und seine Faszination damals wie heute ungebrochen. Er kommt nicht nur in vielerlei Gestalt daher, sondern erfüllt auch unterschiedliche Funktionen, die in dieser Märchensammlung zu den drei wichtigsten Gruppen zusammengefasst sind: der überlistete, der dämonische und der hilfreiche Teufel.
Mir kritischem Blick auf die unterschiedlichen Deutungsansätze leistet das Werk einen wichtigen Beitrag zur Märchenforschung
Geschichten aus einem ereignislosen Land
- 197 Seiten
- 7 Lesestunden