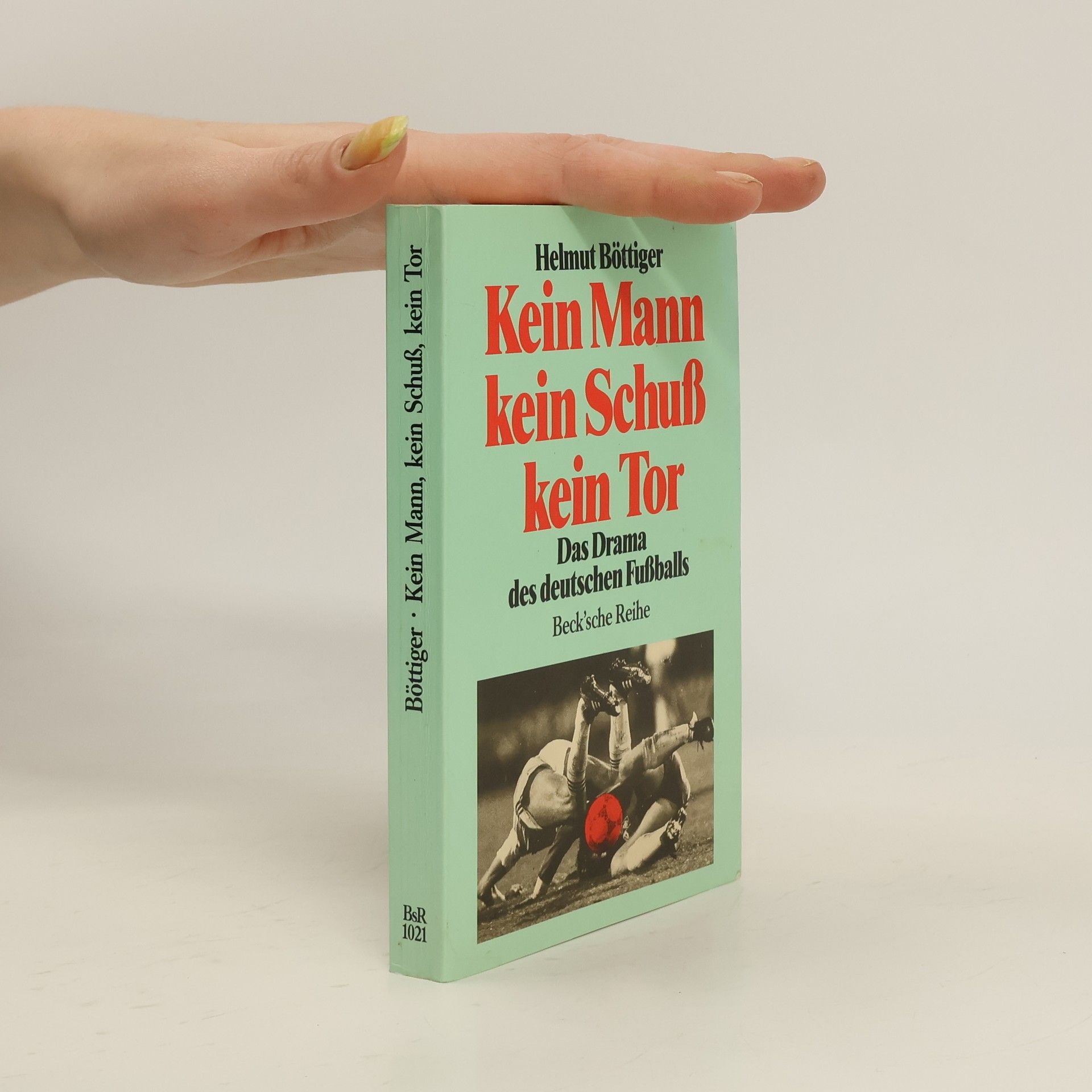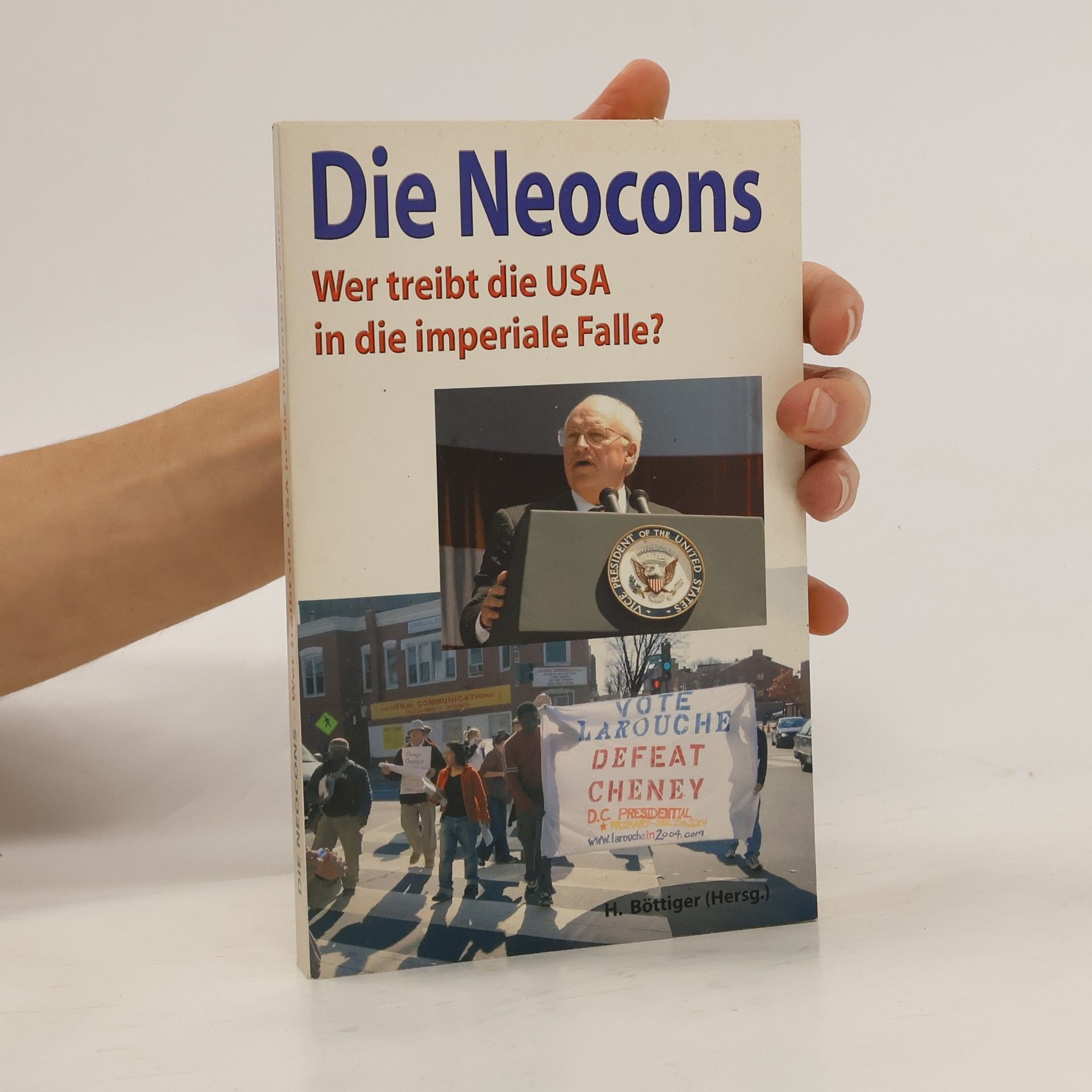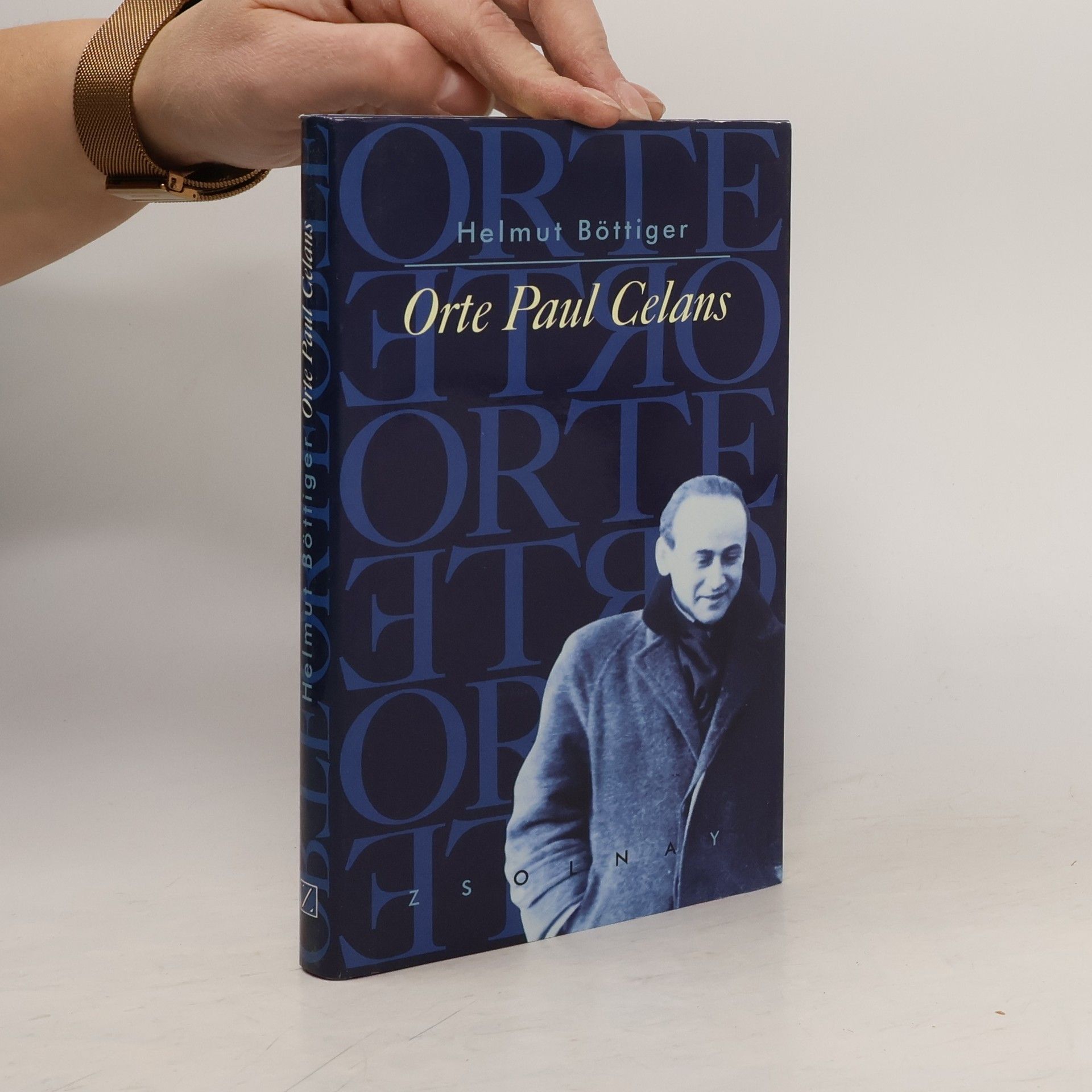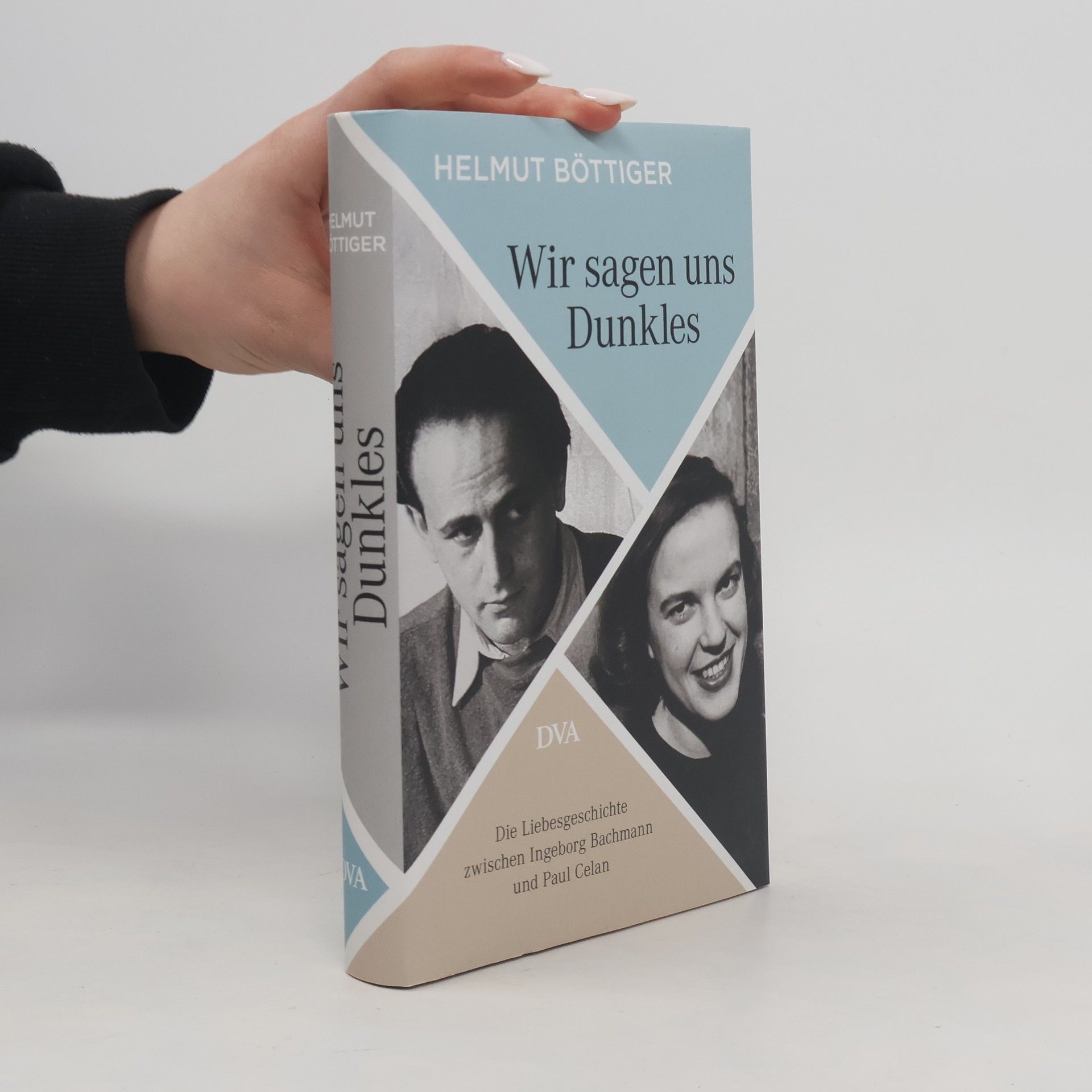Die Jahre der wahren Empfindung
Die 70er - eine wilde Blütezeit der deutschen Literatur
- 473 Seiten
- 17 Lesestunden
Die Literaturgeschichte der 70er Jahre wird als faszinierende Zeit- und Gesellschaftsgeschichte dargestellt. Helmut Böttiger skizziert ein differenziertes Bild der politischen, kulturellen und literarischen Prozesse zwischen Aufbruch und Desillusionierung. Er diagnostiziert in Peter Schneiders Erzählung 'Lenz' eine 'plötzliche Verunsicherung' der Literatur zu Beginn des Jahrzehnts und untersucht deren Wurzeln und Konsequenzen in den Werken bedeutender Autorinnen und Autoren. Hermann Peter Piwitt, Bernward Vesper und Christoph Meckel thematisieren die Auseinandersetzungen mit den Nazi-Vätern, während ein weiteres Kapitel den neuen Ton beleuchtet, den Autorinnen wie Karin Struck und Verena Stefan in die Literatur einbrachten. An Nicolas Born und Rolf Dieter Brinkmann erkennt Böttiger symptomatische Sprechweisen in der Lyrik dieser Jahre. In einzelnen Kapiteln analysiert Böttiger literaturhistorische Zusammenhänge sowie individuelle Korrespondenzen und Unterschiede zwischen Werken von Ingeborg Bachmann, Peter Handke, Wolf Biermann, Christa Wolf und anderen. Ein Kapitel widmet sich den neu entstandenen Alternativzeitschriften, Verlagen und Buchhandlungen, während ein weiteres speziell dem Wagenbach-Rotbuch-Komplex gewidmet ist.