In diesem Buch untersucht Stefan Kühl das Phänomen der Regelabweichungen in Organisationen. Er analysiert, wie solche Verstöße sowohl nützlich als auch riskant sein können und beleuchtet die Bedingungen, unter denen sie auftreten. Anhand konkreter Fälle werden die Chancen und Herausforderungen von "brauchbarer Illegalität" dargestellt.
Stefan Kühl Bücher

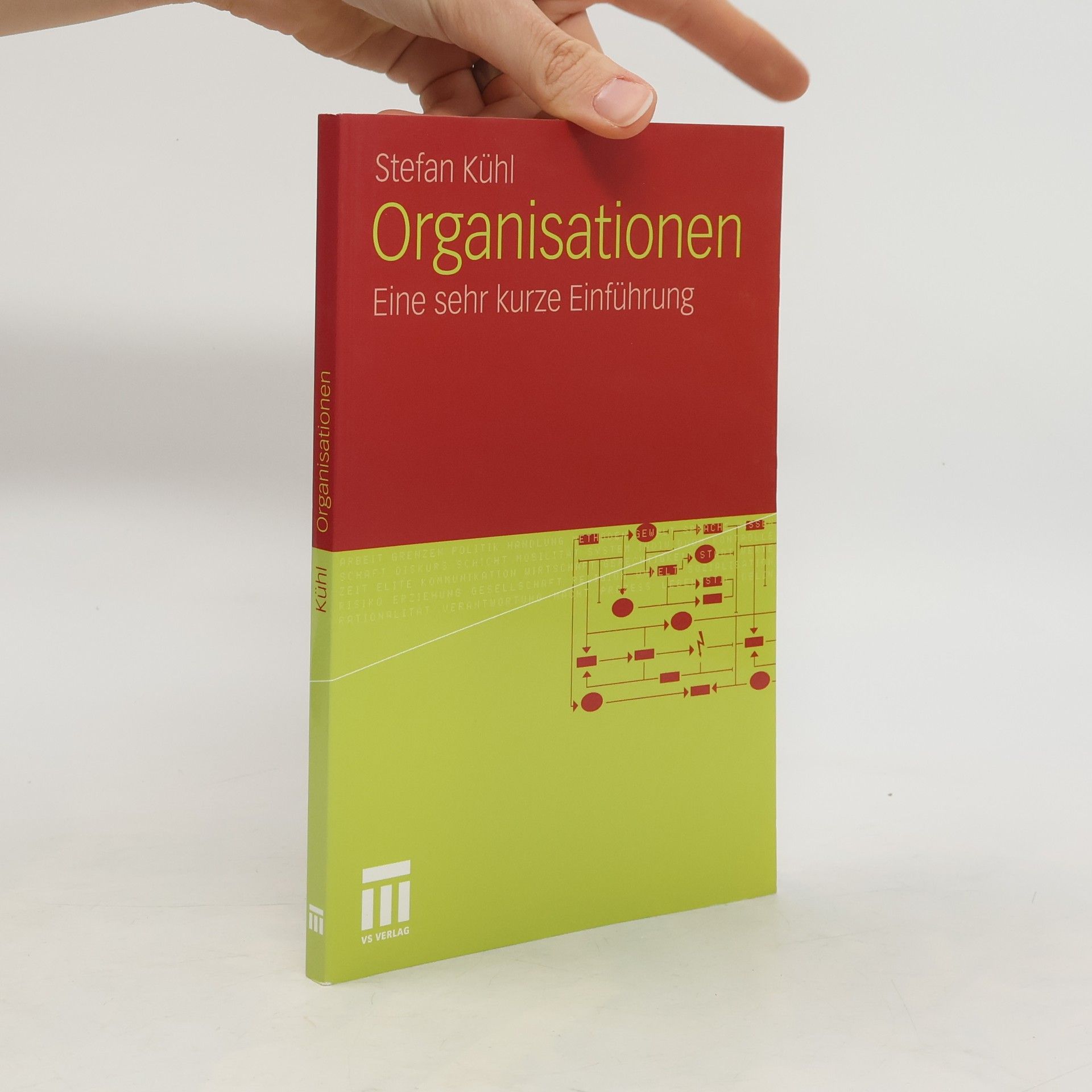

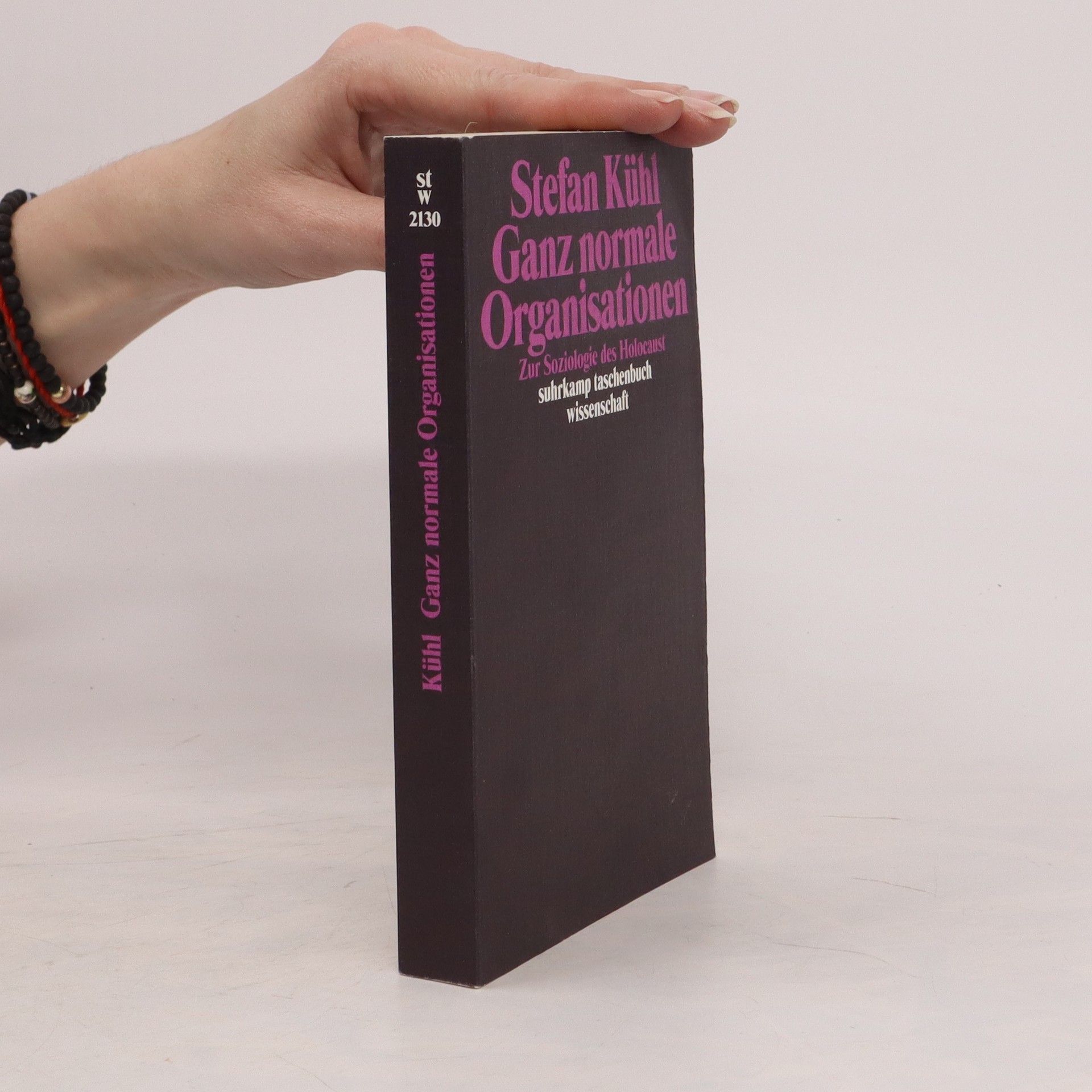


Das Regenmacher-Phänomen
- 236 Seiten
- 9 Lesestunden
Die Konzepte der lernenden Organisation und des permantenen Wandels gelten derzeit als Wundermittel für den Erfolg. Stefan Kühl wagt den Widerspruch: Es gibt, so seine These, gute Gründe die vorgeschlagenen Regeln für Lernen und Wandel in Organisationen kritisch zu sehen. Die als Erfolgsrezepte gehandelten Prinzipien wie klare Zielvereinbarungen, Mitarbeiteridentifikation und permantenes Lernen stecken voller Widersprüche. Stefan Kühl macht auf diese Problematik aufmerksam. Er legt die Widersprüche offen und schlägt eine Brücke zwischen Theorie und Praxis, um ein besseres Verständnis von Wandel zu entwickeln.
Warum waren während der Zeit des Nationalsozialismus so viele Deutsche bereit, sich an der Vernichtung der europäischen Juden aktiv zu beteiligen? Stefan Kühl behauptet: Es war die Einbindung in Organisationen des NS-Staats, die diese Menschen dazu gebracht hat, sich an Deportationen und Massenerschießungen zu beteiligen – und zwar unabhängig von den ganz unterschiedlichen Motiven, die sie ursprünglich zum Eintritt in diese Organisationen bewogen haben. Kühl belegt diese These unter Einbeziehung der einschlägigen geschichtswissenschaftlichen und sozialpsychologischen Forschung, aber mit dem theoretischen Instrumentarium der Soziologie. Er zeigt damit auch, was diese wissenschaftliche Disziplin mit Blick auf das Thema zu leisten vermag.
Wenn die Affen den Zoo regieren
- 187 Seiten
- 7 Lesestunden
Über den Autor Dr. Stefan Kühl ist Dozent für Organisationssoziologie an der Universität München und Unternehmensberater bei Metaplan. Aufgrund dieser beiden Standbeine verbindet er den Einblick in die Praxis mit wissenschaftlicher Fundierung. Er ist Autor von Wenn die Affen den Zoo regieren und Das Regenmacher-Phänomen und Herausgeber des Handbuchs Methoden der Organisationsforschung. Leseprobe. Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Rechteinhaber. Alle Rechte vorbehalten. Teil III Wandel über alles - Die neuen revolutionären Unternehmen Der Paradigmenwechsel Ich sitze am Straßenrand Der Fahrer wechselt das Paradigma Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. Warum sehe ich den Paradigmenwechsel Mit Ungeduld? Bert Brecht Die aktuelle Managementliteratur suggeriert, wie der Berliner Systemtheoretiker Dirk Baecker feststellt, daß man auf die alten Formen hierarchischer Unternehmen nicht nur verzichten muß, sondern inzwischen dank überzeugender Alternativen auch verzichten kann (1992a: 48). "Wir sollten Wandel als das einzige Stabile anerkennen." Mit diesen Worten beschreibt Jürgen Fuchs von der Ploenzke Gruppe die Grundlage für diese Alternativen (Fuchs 1992d: 45). Der Geschäftsführer der von mir untersuchten Bell Group in New Mexico, Hugh Bell, benutzt ganz ähnliche Worte: "Die einzige Sache, die in unserem Unternehmen stabil bleiben wird, ist ständiger Wandel."
Organisationen
- 177 Seiten
- 7 Lesestunden
Von der Wiege bis zur Bahre wird unser Leben durch Organisationen bestimmt. Aber wir sind nicht dafür ausgebildet worden, wie wir als Mitglied mit Unternehmen, Verwaltungen, Universitäten, Schulen, Krankenhäusern, Gefängnissen, Parteien oder Armeen zurechtkommen können. Organisationen – was sind das für „Gebilde“, die unsere moderne Gesellschaft so stark bestimmen? Wie „ticken“ sie? Welche Eingriffsmöglichkeiten gibt es? Anhand der drei zentralen Merkmale Zwecke, Hierarchie und Mitgliedschaften wird grundlegend erklärt, wie Organisationen funktionieren.
Organisationen im Labor?
Grenzen der Simulation von Formalität in gruppendynamischen Trainings
- 59 Seiten
- 3 Lesestunden
Schattenorganisation
Agiles Management und ungewollte Bürokratisierung
Stefan Kühl zeigt in diesem Buch, dass es gerade in agilen Organisationen einen Trend zur Hyperformalisierung gibt. Denn um den Abbau von Hierarchie und die Aufweichung von Abteilungsgrenzen zu erreichen, werden in agilen Organisationen in einem bisher nicht bekannten Maße formale Rollenbeschreibungen angefertigt. Ergebnis dieser Überbürokratisierung sind eine ganze Reihe ungewollter Nebenfolgen, die Organisationen blockieren können. Um handlungsfähig zu bleiben, so zeigt Stefan Kühl anhand von zahlreichen Beispielen aus der Unternehmenspraxis, bilden Organisationen Schattenhierarchien und Schattenabteilungen aus.
Methoden der Organisationsforschung
- 441 Seiten
- 16 Lesestunden
Beziehungsweisen. Von Freundschaften und Gruppen
Mittelweg 36, Heft 5 Oktober/November 2023
Der Mensch ist ein soziales, zur Geselligkeit veranlagtes Tier, das Freundschaften knüpft, Familien bildet und Vereine gründet. Ungeachtet durchaus vorhandener Gemeinsamkeiten untersucht die Soziologie, mit deren Hilfe der Mensch sein geselliges Treiben beobachtet, die vielfältigen Zusammenschlüsse meist je für sich. Das gilt nicht zuletzt für die bislang eher unvermittelt nebeneinander existierenden Stränge der Gruppen- und der Freundschaftssoziologie. Doch was wäre, wenn die Beteiligten auch in diesem Fall gemeinsame Sache machten und ihre Kompetenzen vereinten? Ließen sich auf diese Weise vielleicht neue Einsichten in die Formen unseres Zusammenlebens gewinnen? Und könnte daraus womöglich etwas Neues entstehen? »Unser Ziel ist es, die Forschungsstränge der Freundschaftssoziologie und der Gruppensoziologie enger zusammenzuführen. Wir gehen dabei von der Beobachtung aus, dass die Freundschafts- und die Gruppensoziologie die gleichen sozialen Phänomene ins Auge fassen, sie lediglich unter unterschiedlichen Gesichtspunkten beschreiben.« Stefan Kühl / Janosch Schobin
Workshops sind im Vorfeld konzipierte, moderiete Arbeitstreffen, bei denen sich Teilnehmende außerhalb der organisationalen Regelinteraktion einer eingegrenzten Thematik widmen. In der Moderatoren- und Berater-Branche hat sich in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel in der Planung und Durchführung von Workshops ausgebildet. Nach dem neuen Paradigma werden Workshops als Elemente in breiter angelegten Interaktionsplänen verstanden, in welchen sie durch ihnen gleichrangige Interaktionsanlässe wie Kontraktgespräche, Sondierungsinterviews oder Großkonferenzen ergänzt werden. Insbesondere dort, wo Workshops auf organisationale Veränderungen zielen, werden sie in eine umfassendere Veränderungsarchitektur eingebettet. In diesem Buch wird kompakt gezeigt, wie man Workshops in einen umfassenden Interaktionsplan einwebt und somit als Element organisationaler Veränderungsprozesse nutzen kann.
