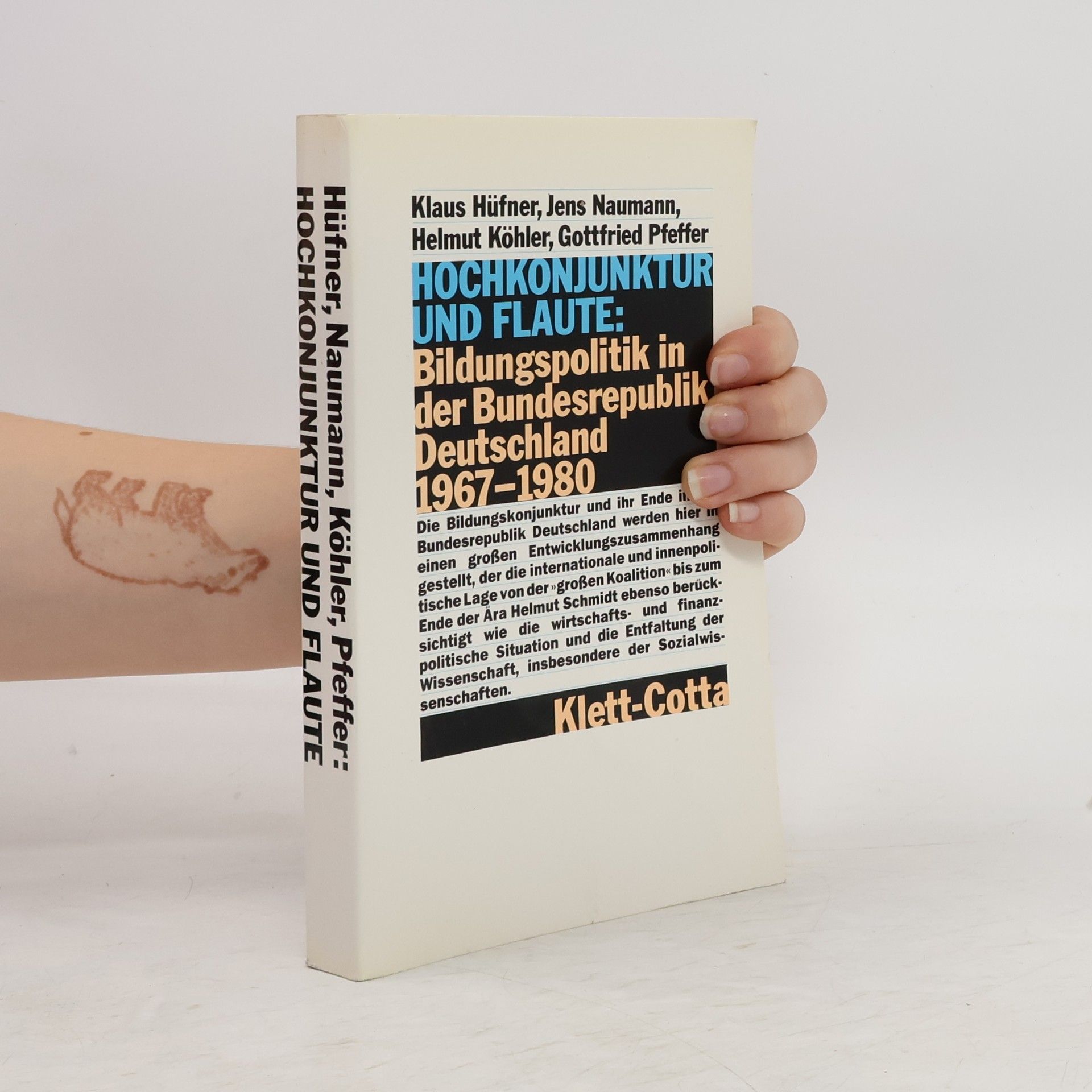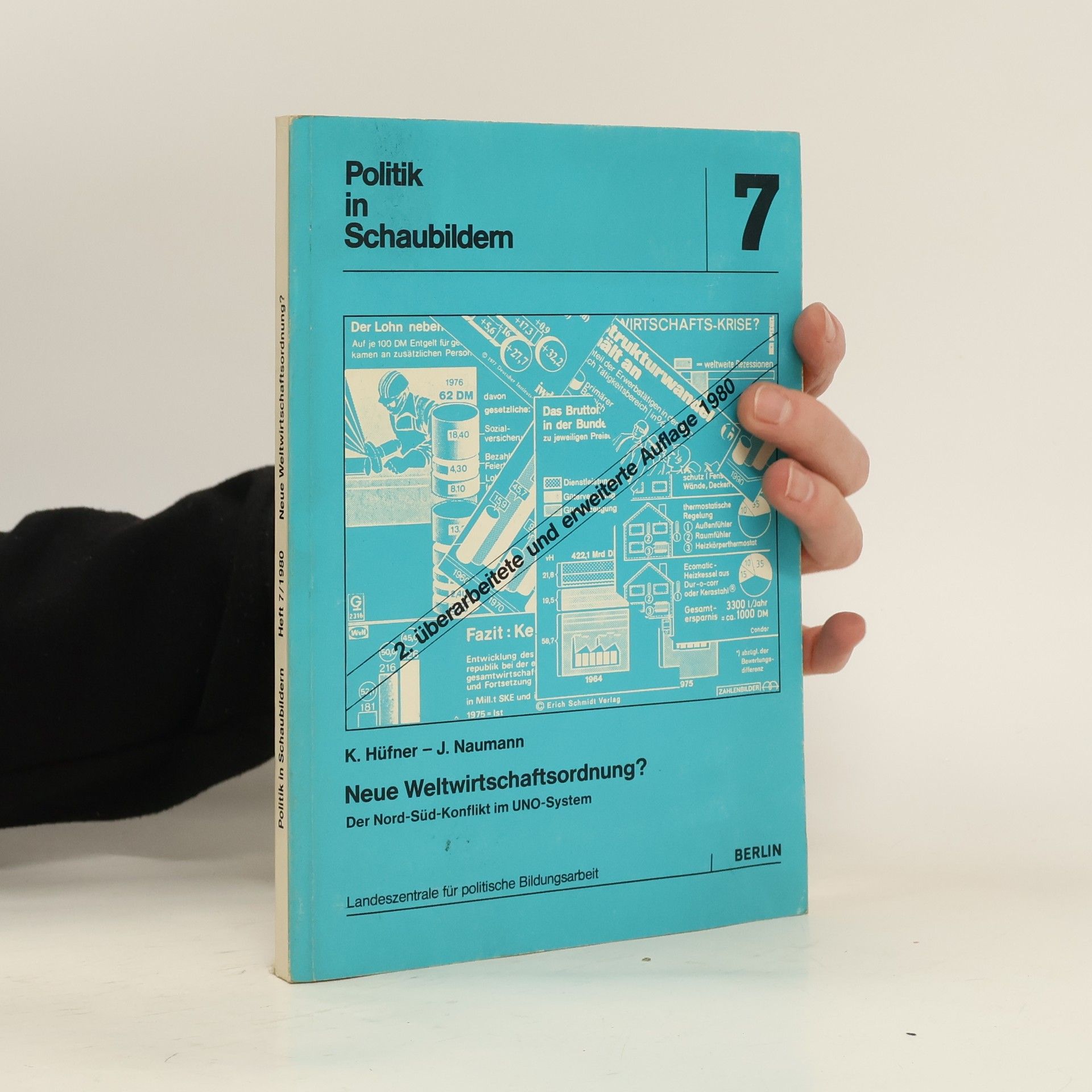Deutsche Mitarbeit im System der Vereinten Nationen 19502023
- 152 Seiten
- 6 Lesestunden
Die Entwicklung der Beziehung zwischen Deutschland und der UNO wird umfassend beleuchtet, beginnend mit der "Quasi-Mitgliedschaft" der Bundesrepublik seit 1950. Der Autor analysiert die aktive Rolle Deutschlands in UN-Sonderorganisationen und die finanzielle Unterstützung, die maßgeblich zur Verhinderung der DDR-Mitgliedschaft beitrug. Mit der Aufnahme beider deutscher Staaten 1973 ändert sich die Dynamik, wobei die Bundesrepublik bis 1990 als wirtschaftlich dominierend hervorsticht. Die Studie umfasst auch die deutsche UN-Politik zu Themen wie Menschenrechten und Friedenskonsolidierung bis hin zu aktuellen Herausforderungen.