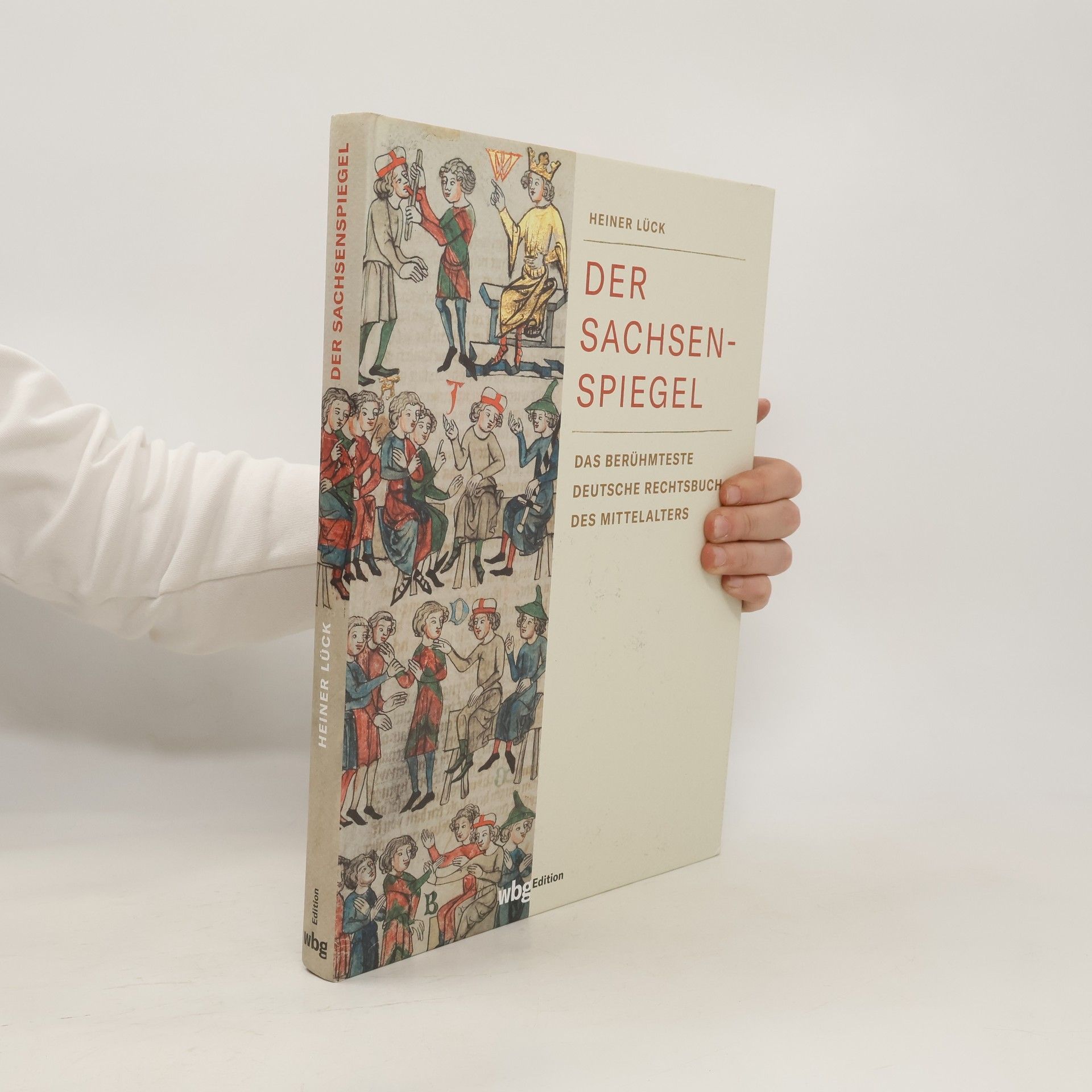Der Sachsenspiegel
Das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters als preiswerte Sonderausgabe
Der Sachsenspiegel ist das fundamentale deutsche Rechtsbuch und gilt zugleich als erstes Prosawerk in deutscher Sprache. Die vier erhaltenen Bilderhandschriften sind von großer Bedeutung für die mittelalterliche Kultur- und Rechtsgeschichte. Lück erklärt in diesem reich illustrierten Band Entstehung, Inhalt, Wirkung und Verbreitung.