Schleswig-Holstein. Literaturland im Norden
Von Achterwehr bis Wrist, von Andersen bis Zaimoglu
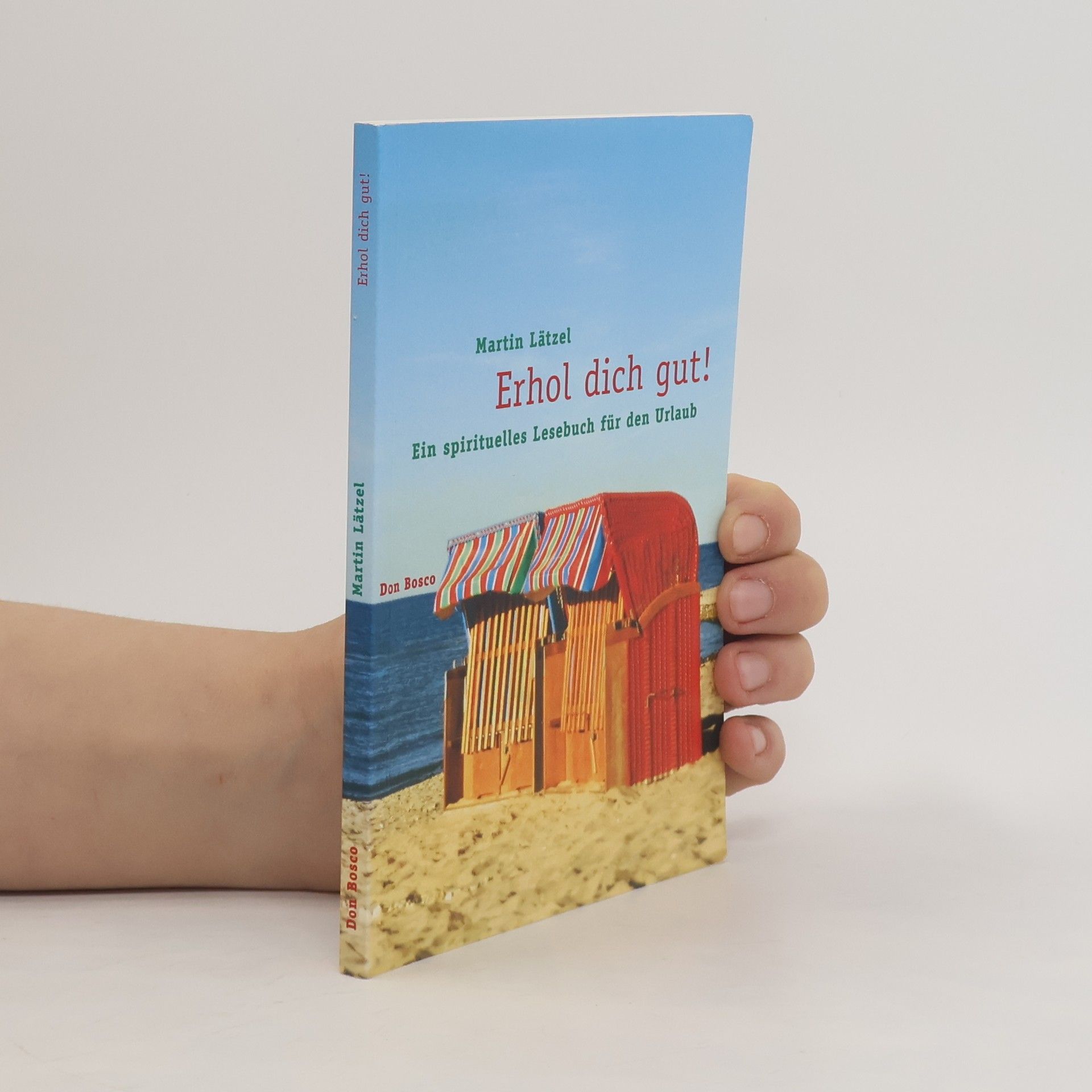



Von Achterwehr bis Wrist, von Andersen bis Zaimoglu
1918: In Kiel meutern die Matrosen und ihr Protest erreicht auch die abgelegene Marinestation Sonderburg auf Alsen. Dort liegt – im Lazarett – der Schneider Bruno Topff. Bisher nicht besonders auffällig, weder politisch noch militärisch, wird er für ganze drei Tage DER PRÄSIDENT VON ALSEN. Viel ist historisch nicht überliefert, aber Martin Lätzel, Autor und Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek, spinnt aus dem Wenigen eine faszinierende historische Fiktion, das lebendige Bild einer turbulenten Zeit.
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein wichtiges Zukunftsthema. Neben vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten gibt es Vorbehalte gegenüber KI-gestützten Anwendungen. Dies gilt gerade für den Bereich der Kultur. KI kommt. Deswegen ist ein verantwortungsvoller Umgang notwendig. Der vorliegende Band skizziert Voraussetzungen, Chancen und Probleme, indem er Forschungsergebnisse zum Einsatz von KI in Kultureinrichtungen vorstellt und diskutiert. Klug eingesetzt, eröffnen durch KI verarbeitete Daten neue Anwendungsmöglichkeiten für Museen, Bibliotheken, Archive oder Theater. Schwerpunkt des Bandes bilden angewandte KI-Projekte aus Schleswig-Holstein. Die Autorinnen und Autoren kommen aus Politik, Wissenschaft und dem Kulturmanagement.