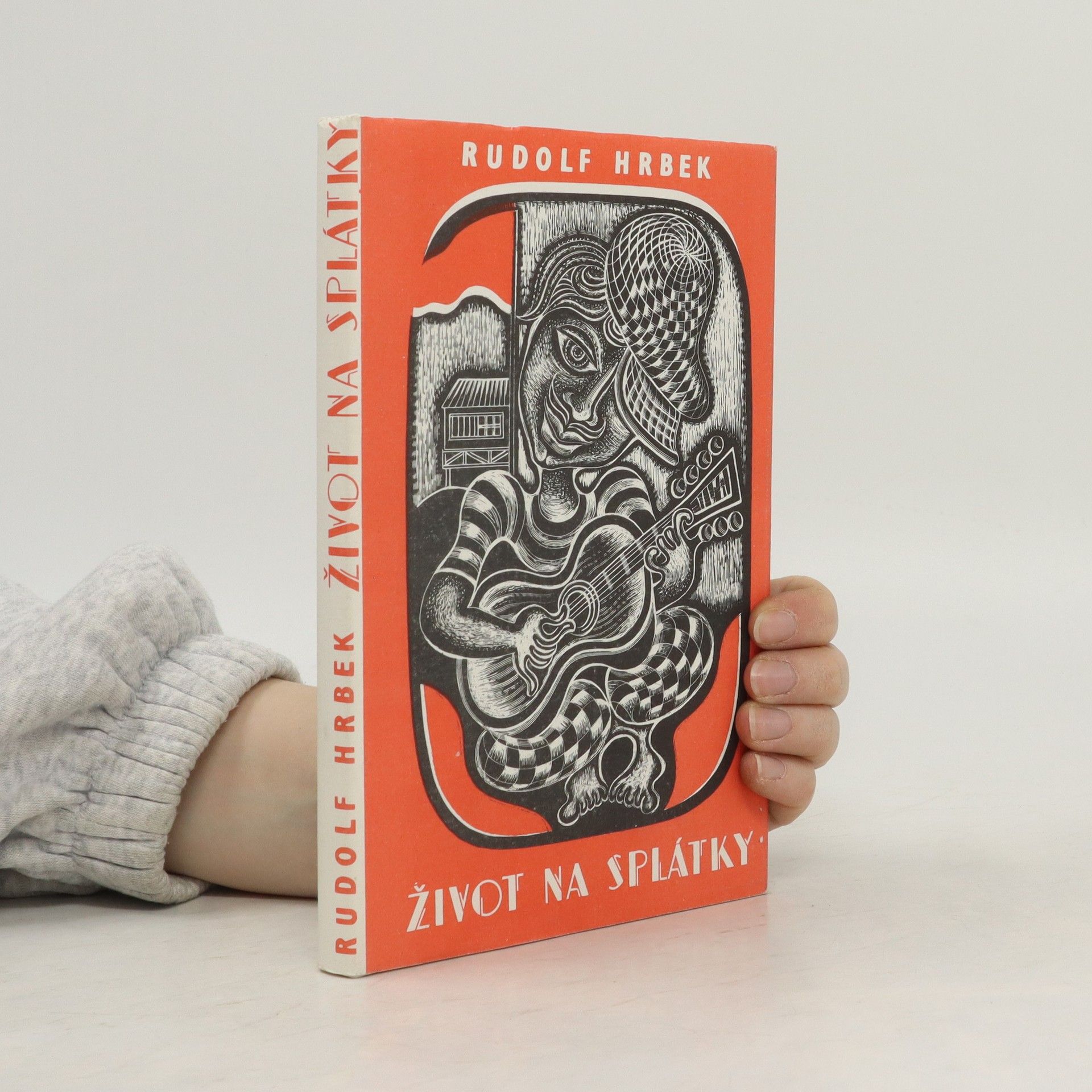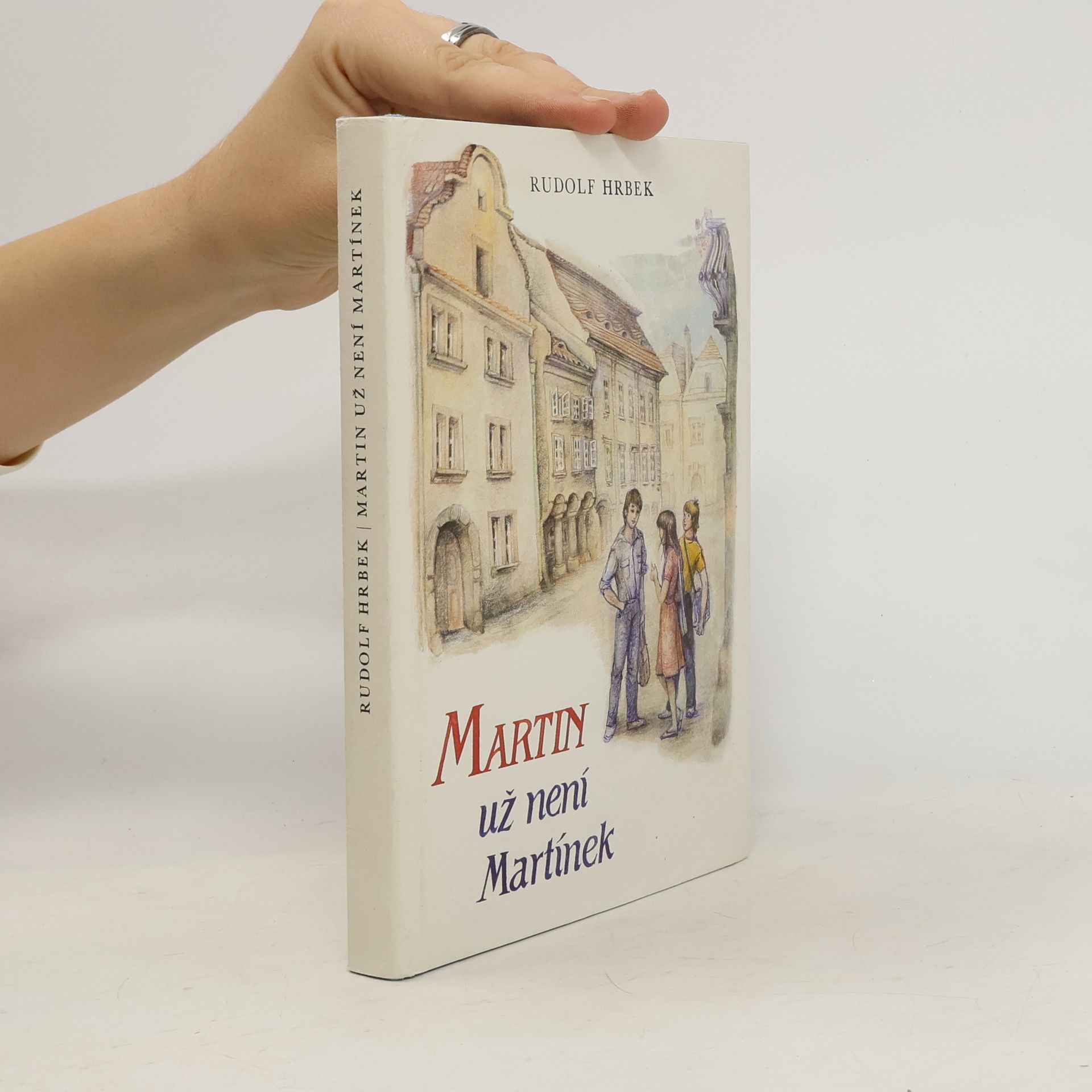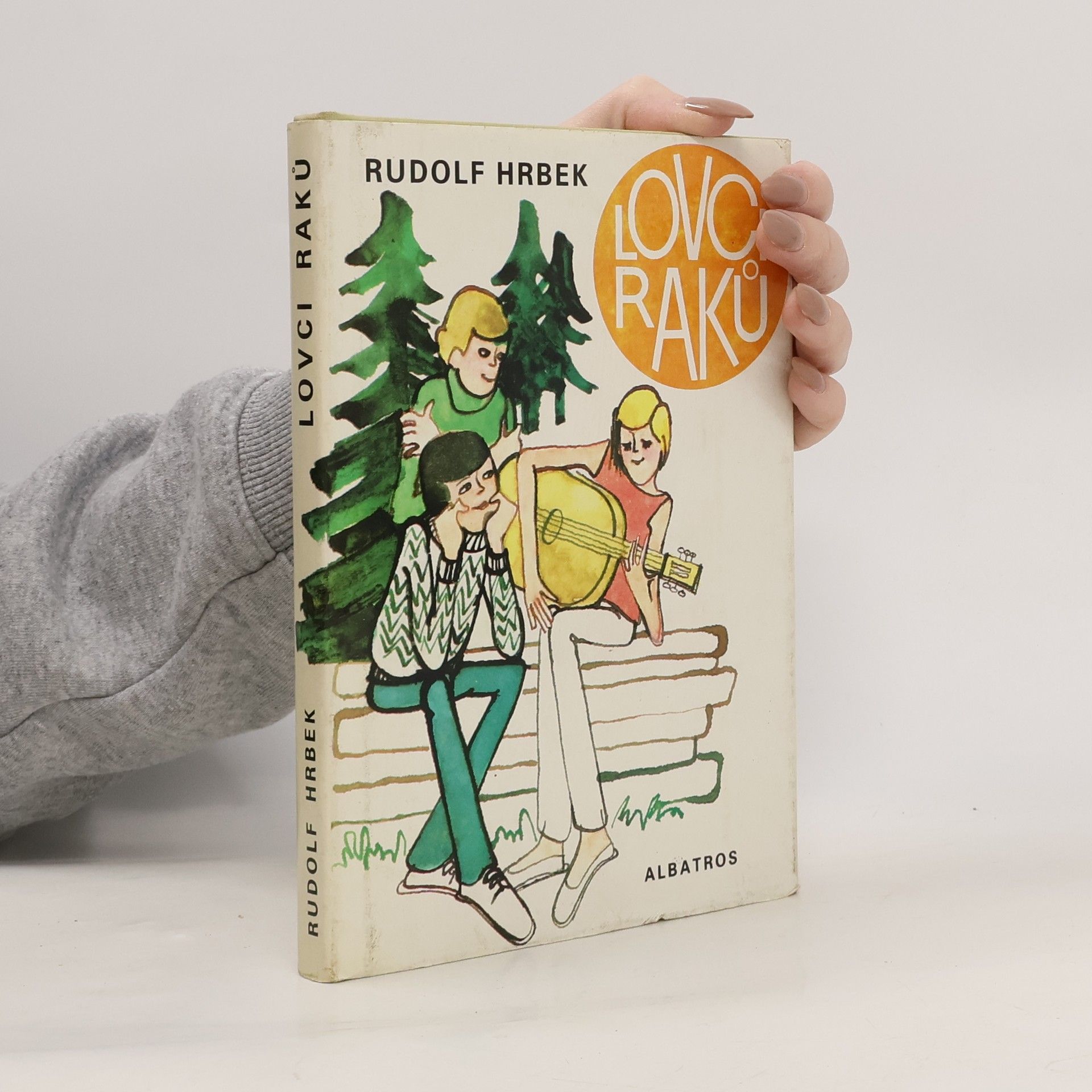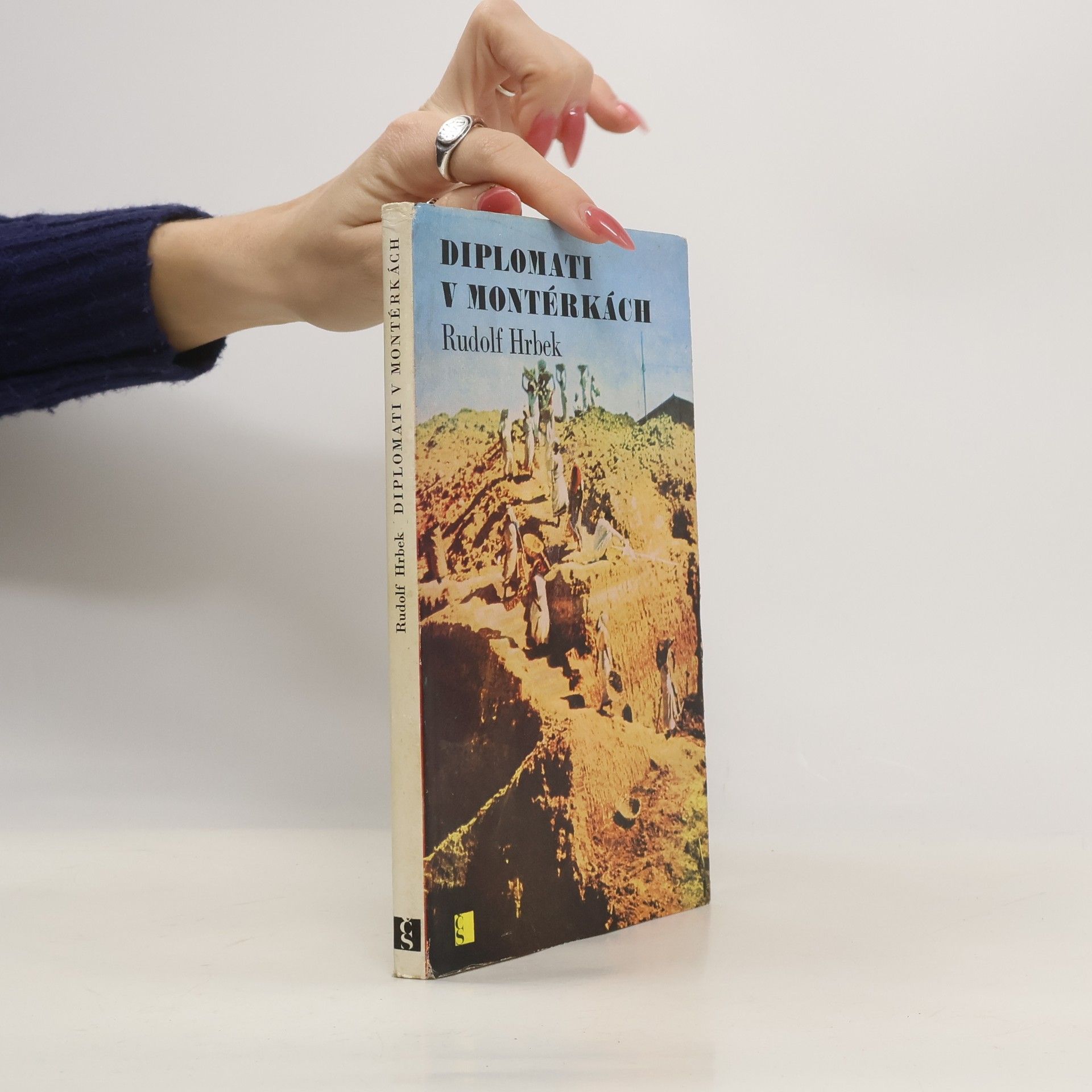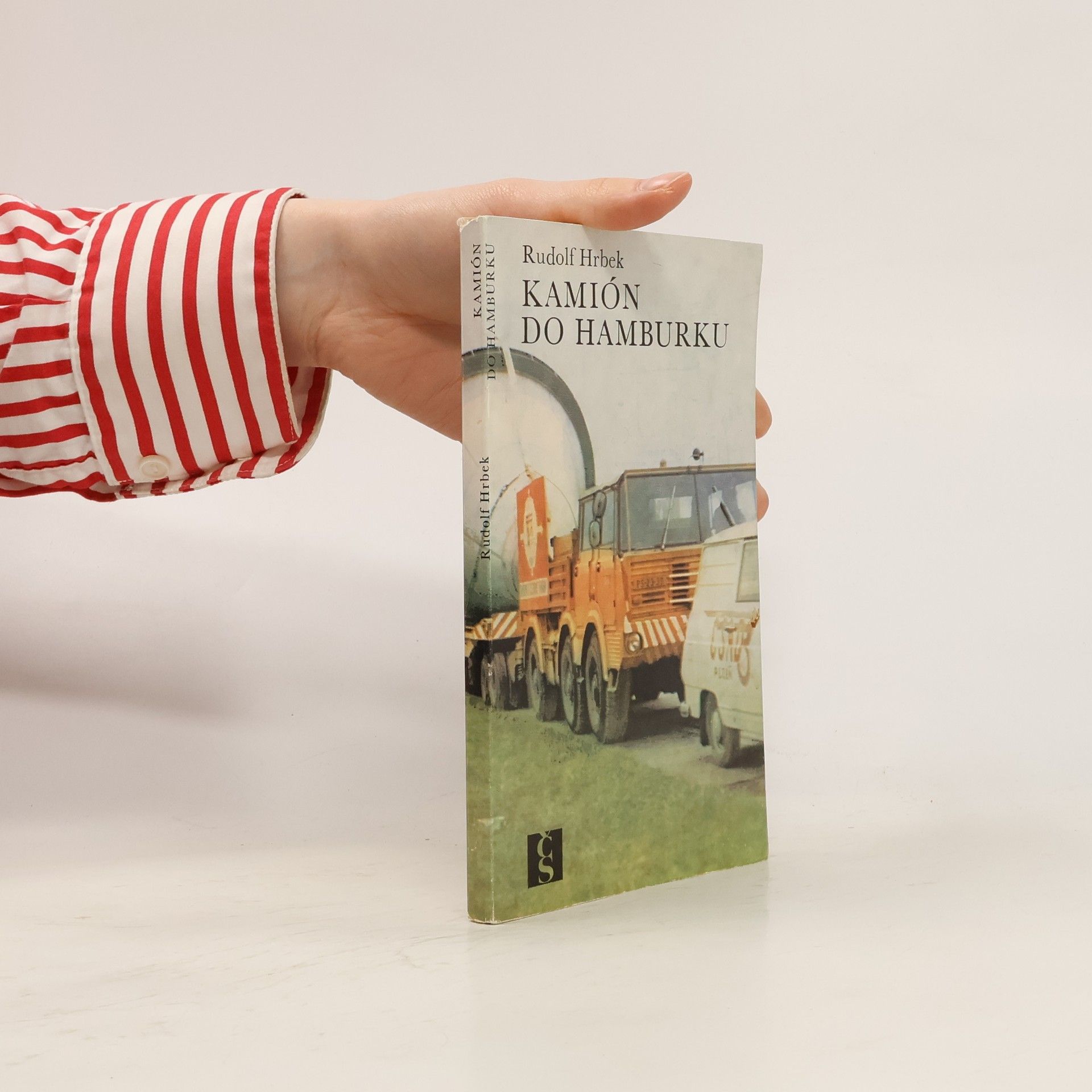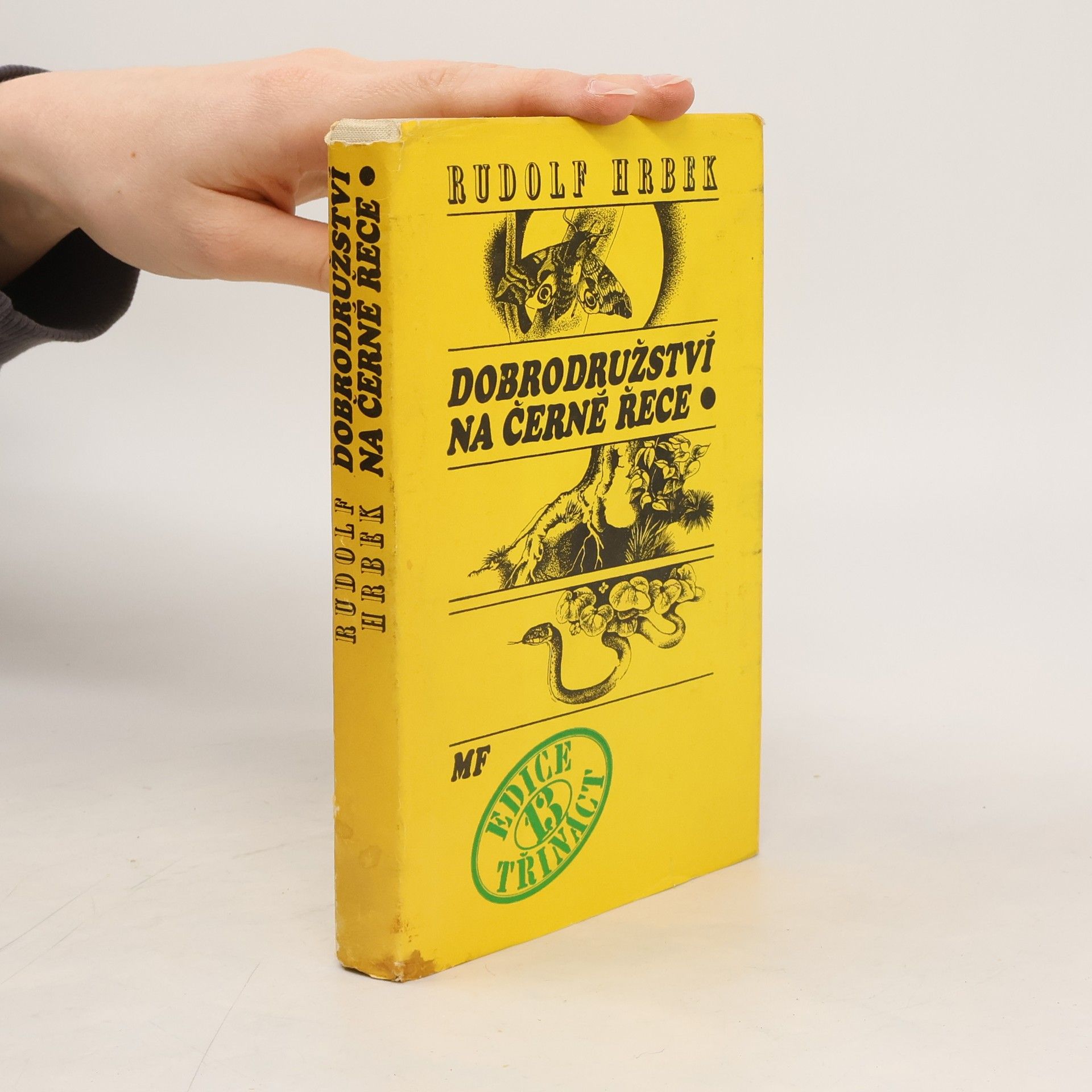Děj se odehrává po osvobození,kdy se na Černou řeku vracejí skalní rybáři Jirka Vít a Bříťa Dušek zvaný prcek.Jejich příhody jsou kaleidoskopem životaživota v Údolí překvapení na Černé řece.
Rudolf Hrbek Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
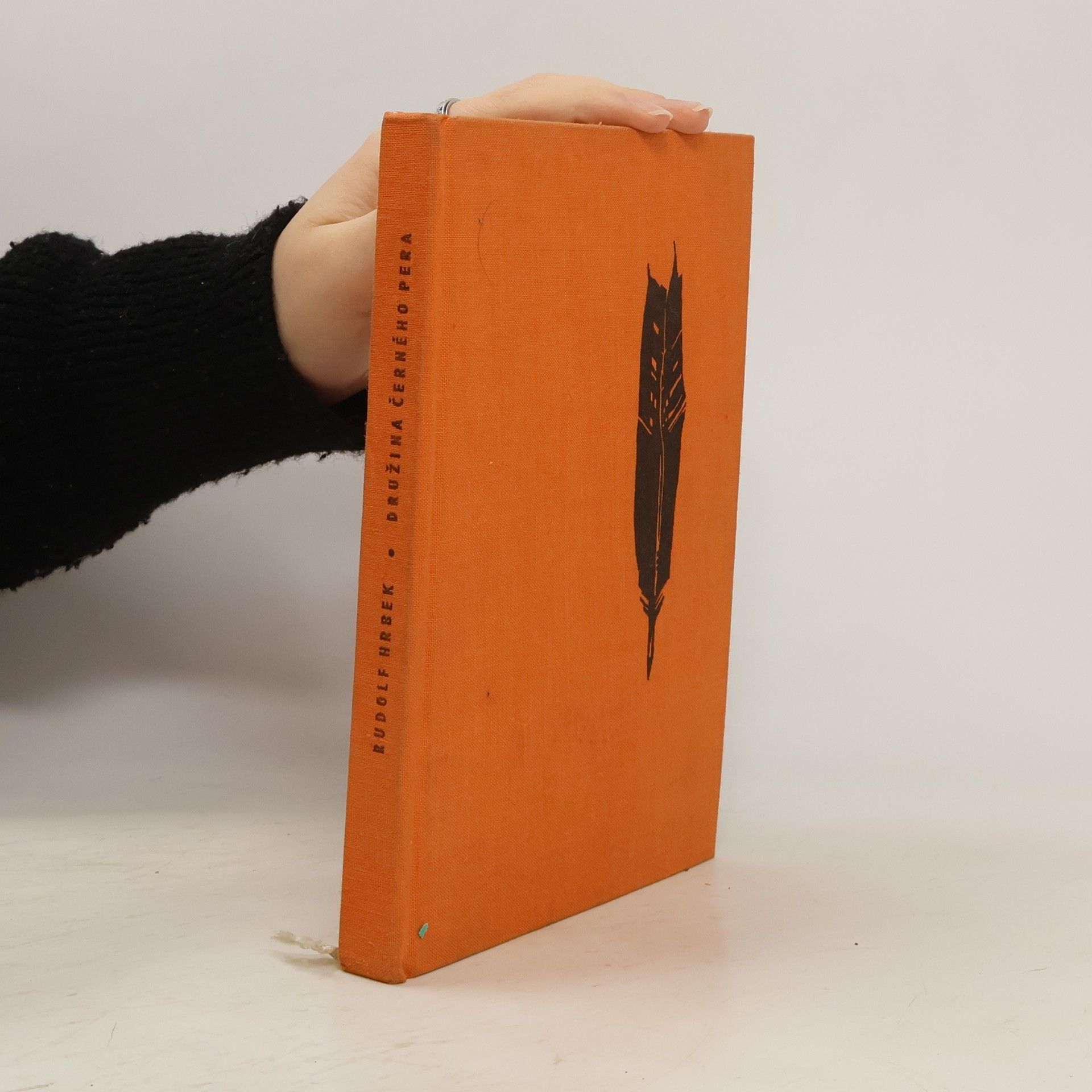
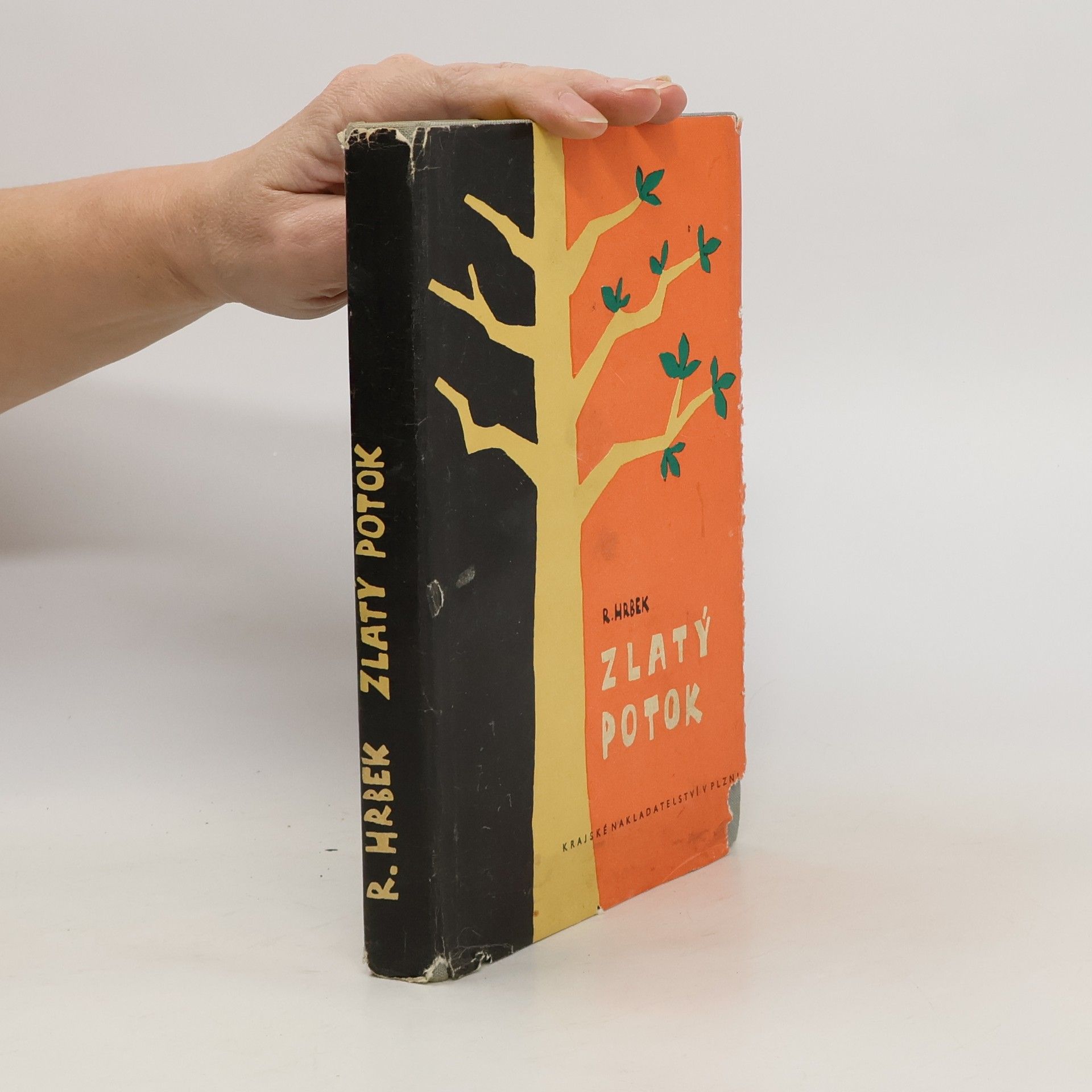
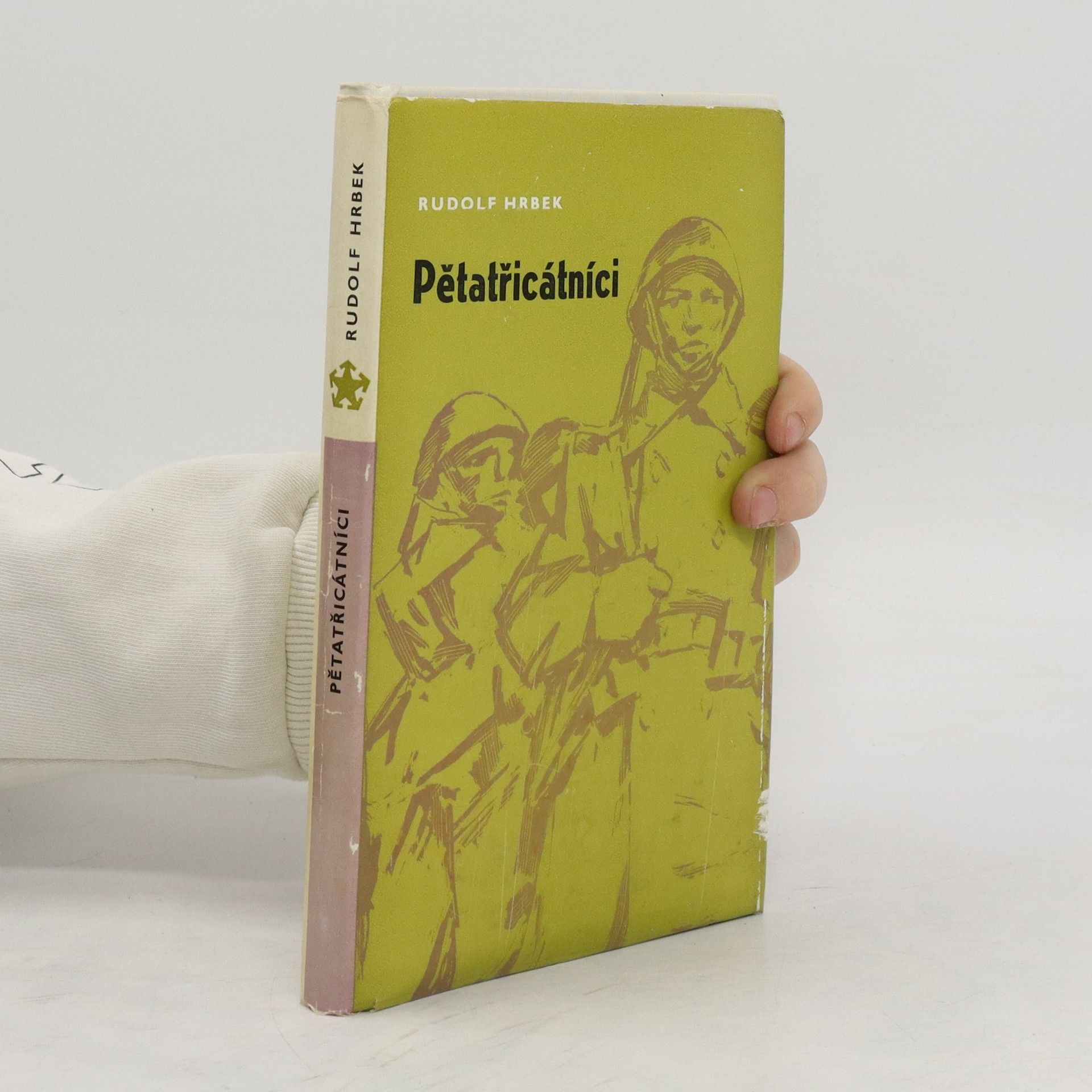
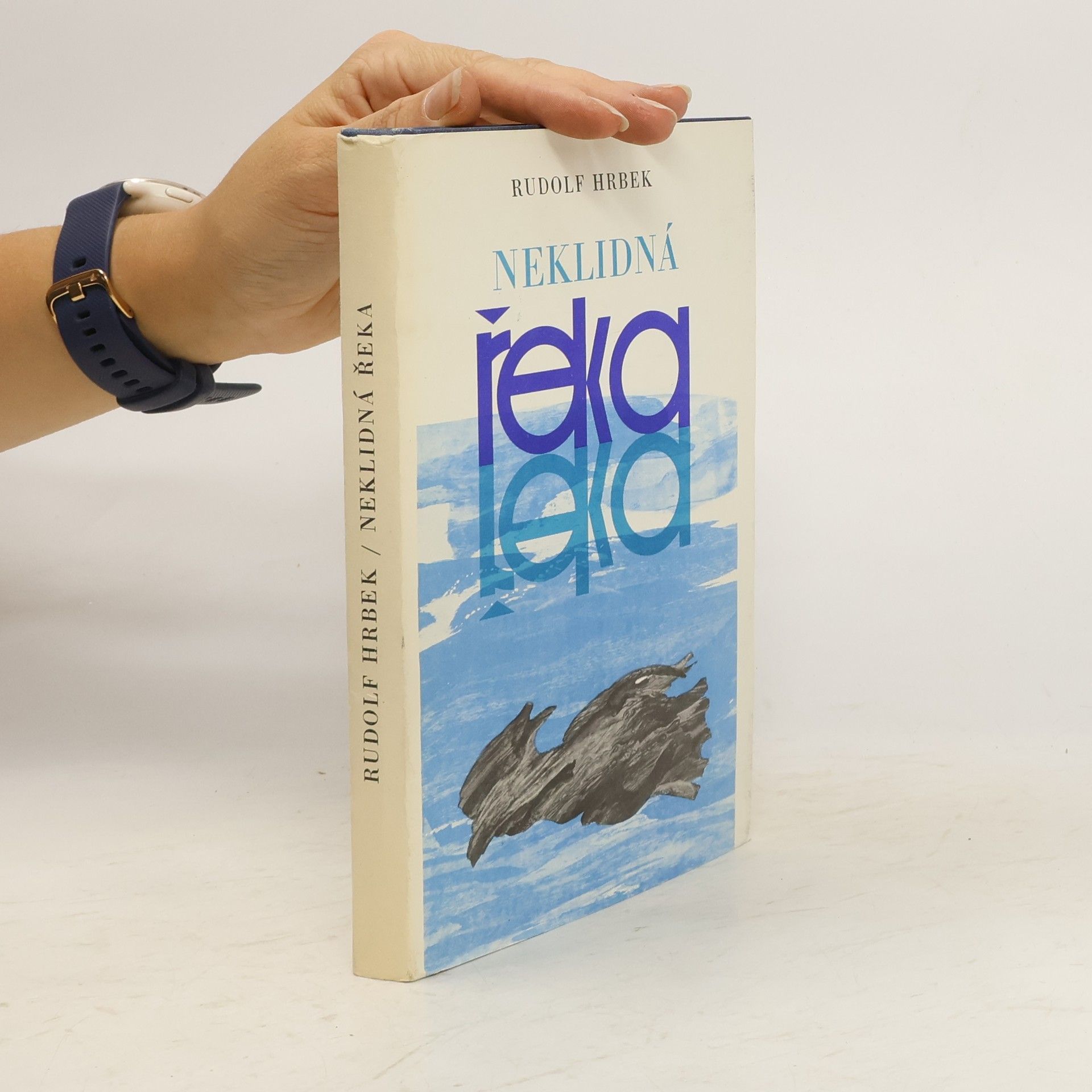
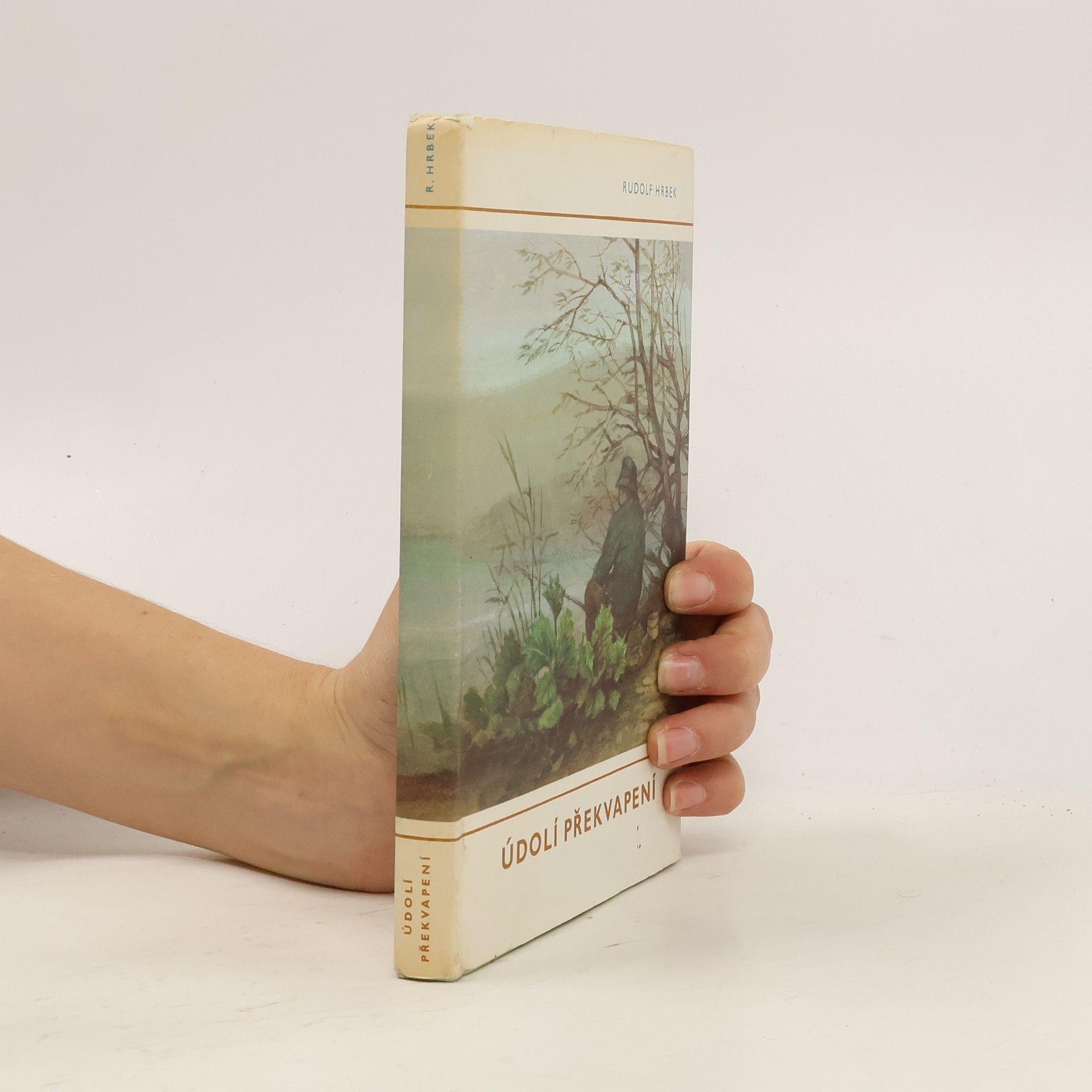
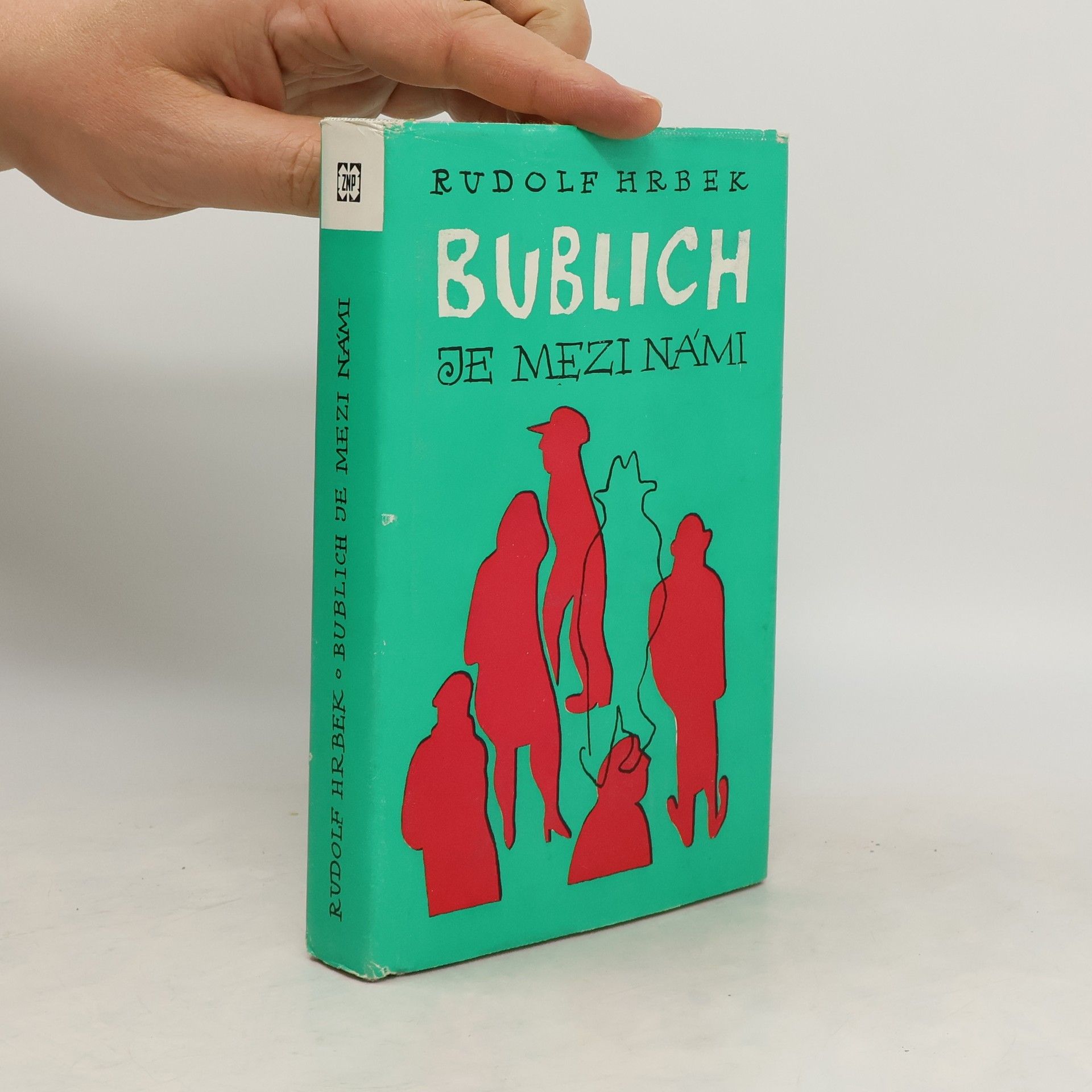
Příběh o dělnickém táboru lidu před Škodovkou v Plzni.
Kniha vypráví o partě dětí z Plzně. Dobrodružství zažívají v plzeňském podzemí.
Román z vesnického prostředí v západočeském pohraničí, zasazeného do půvabné české krajiny v povodí Mže, rozvíjí úsměvné příběhy družstevníků a venkovských řemeslníků, které určitě zaujmou pozorného a vnímavého čtenáře. Máte-li rádi lidové čtení, nebudete určitě zklamáni.
Dobrodružství party dětí, které se naučily v rybářském kroužku od dospělých a moudrých rybářů všemu, co jim nyní pomáhá odhalovat a poznávat velká tajemství naší přírody
Autentické zážitky montéra plzeňské škodovky Petra Kordu z cest po různých krajích světa.
Kniha čerpá ze všedních vojenských dnů chlapců na počátku třicátých let. Na osudech prostého vojáka ukazuje třídní rozpory v armádě první republiky.
Socialistická próza o pracovním dobrodružství při dopravě převodových skříní mamutích rozměrů do Hamburku.
Román je humorně vylíčenou ságou člověka ( Bublicha ),který v touze po majetku využije naučených triků od svého otce - obchodníka - a různých šmelin,aby si "žil ".S velkou znalostí poměrů je zde zachyceno poválečné osidlování pohraničí.
Trampské hnutí vrcholilo ve třicátých letech. V tomto prostředí se pohybuje i skupina mladých chlapců z plzeňské dělnické periférie, tzv. Karlova. O nich a o jejich životě v přírodě vypráví ve své nové knize plzeňský spisovatel R. Hrbek (nar. 1909), kterého znají čtenáři již z jeho předchozích čtyř knih, postupně vydávanych od roku 1960.