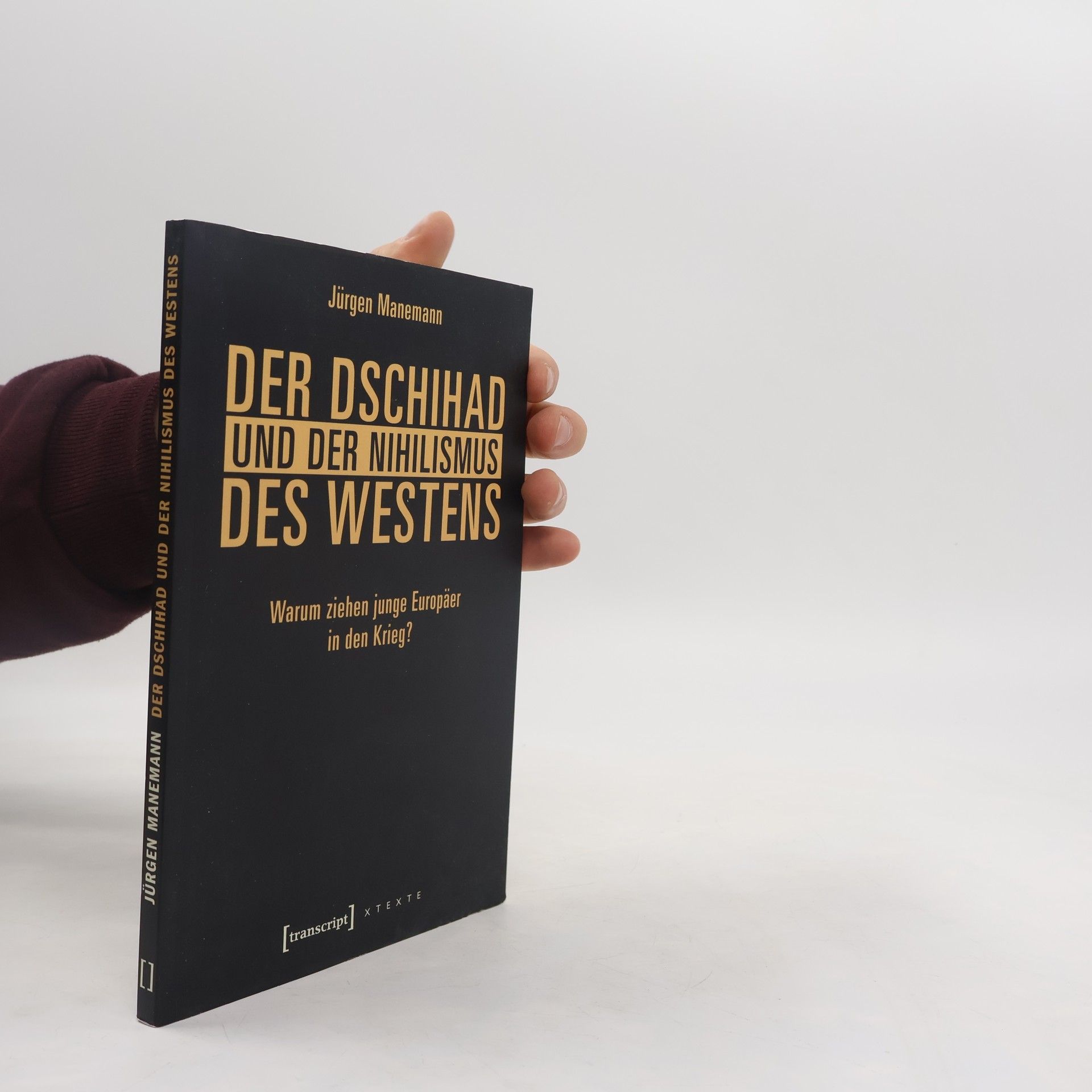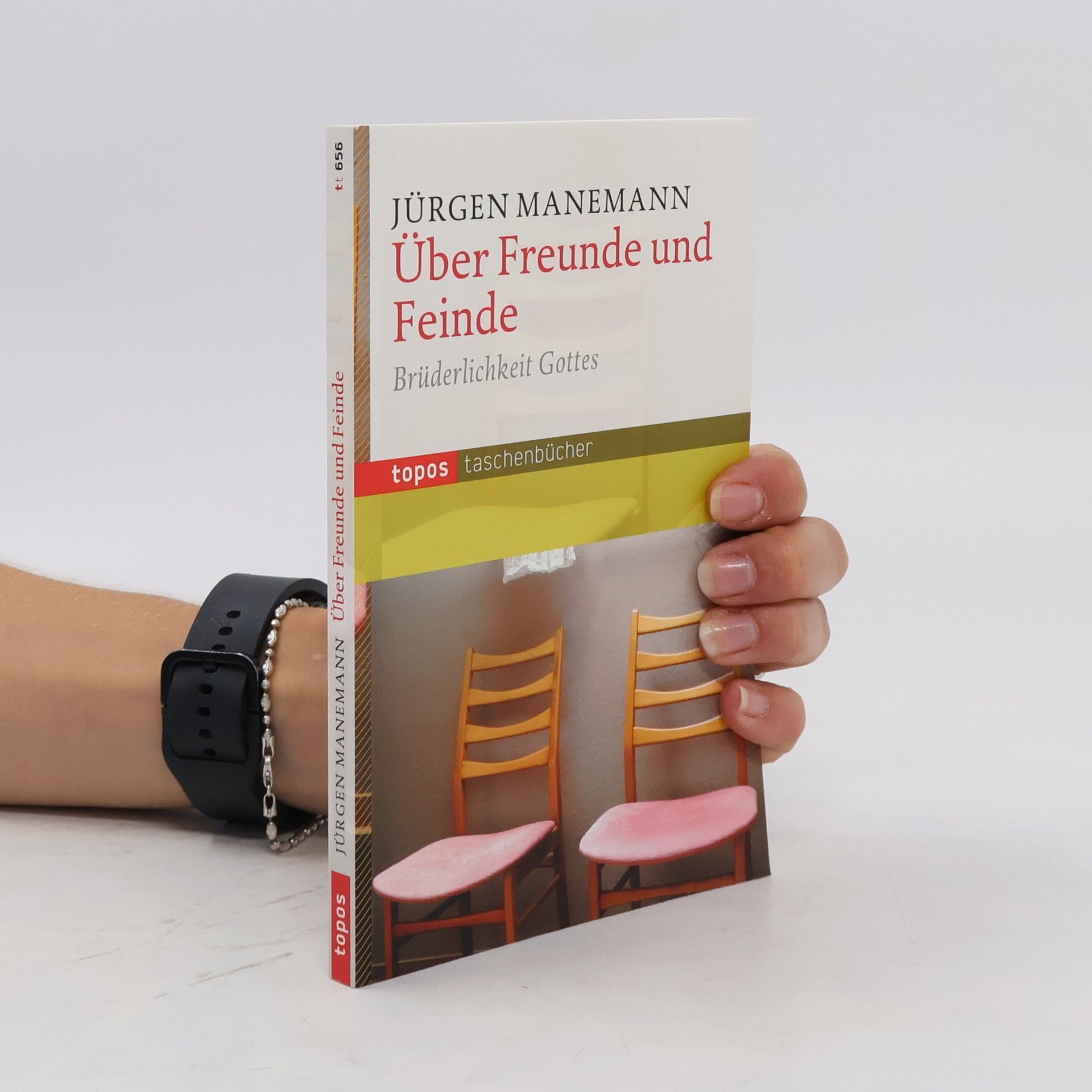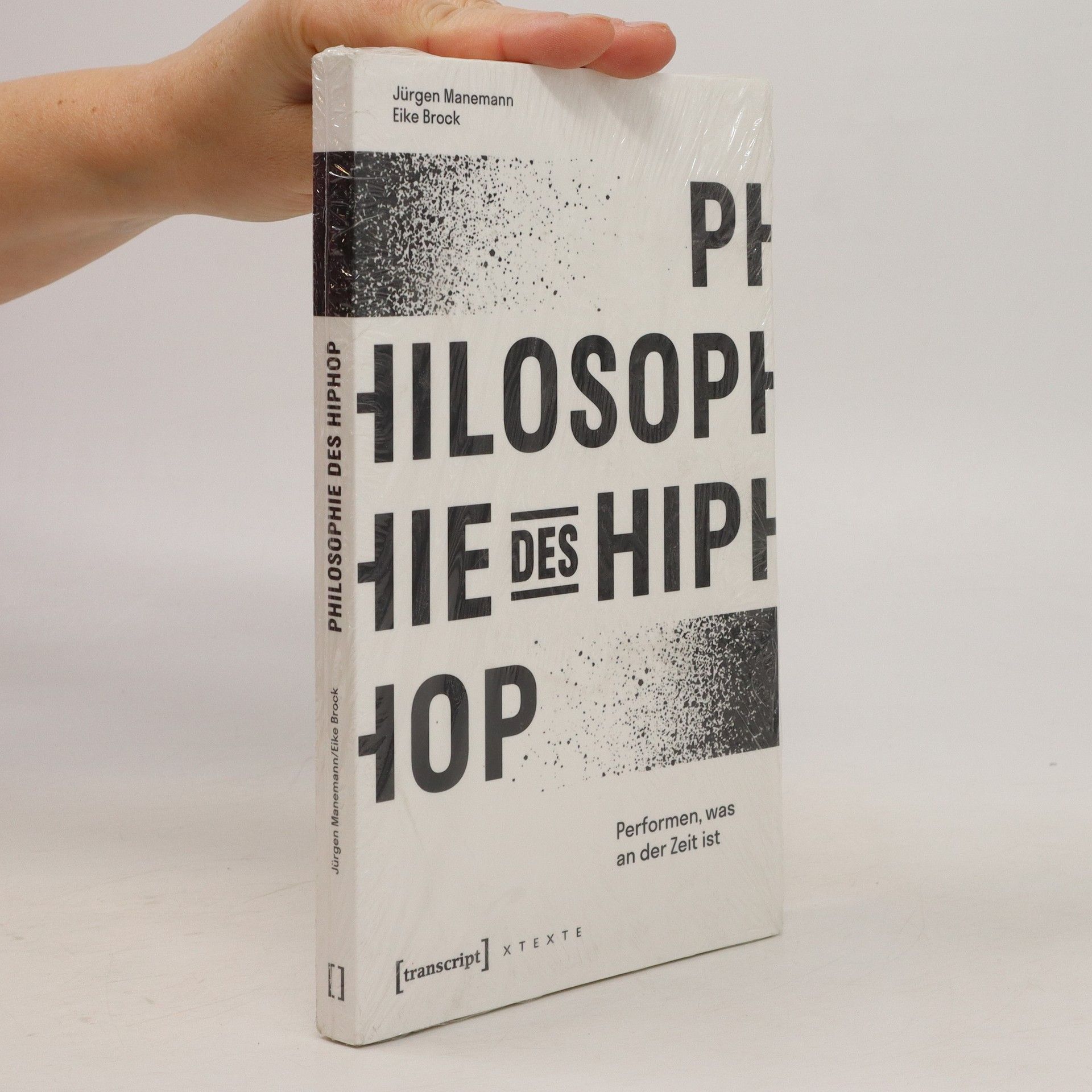Rettende Umweltphilosophie
Von der Notwendigkeit einer aktivistischen Philosophie
Die ökologische und klimatische Katastrophe gefährdet die Grundfesten unserer planetaren Existenzbedingungen. Angesichts der dadurch verursachten Zerstörungen plädiert Jürgen Manemann für eine rettende Umweltphilosophie. Diese erschüttert die Kaltstellungen des wissenschaftlich-technischen Zugriffs auf Natur durch die Konfrontation mit Andersheit und Anderheit in Natur. Rettende Umweltphilosophie zielt auf ein (Zusammen-)Leben, das alle Menschen, Tiere, Pflanzen, Arten, Berge, Flüsse, Ökosysteme und die Erde als Teil der Moralgemeinschaft umfasst. Indem sie sich engagierend und aktivierend um die Handlungsfähigkeit der Menschen sorgt, begründet sie eine Pflicht zum Aktivismus. Rettende Umweltphilosophie schärft den Blick für Utopisches und lässt Neues im Kaputten und in Zwischenräumen aufblitzen.