Jakob Balde (1604-1664) zählt zu den bedeutendsten neulateinischen Dichtern. Seine satirische Schrift "Solatium Podagricorum" wird hier erstmals auf Deutsch veröffentlicht. Sie bietet humorvolle und nachdenkliche Einblicke in die Vorteile der Gicht und reflektiert die Kultur des 17. Jahrhunderts. Ideal für Literatur- und Medizinhistoriker.
Eckard Lefèvre Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
3. September 1935
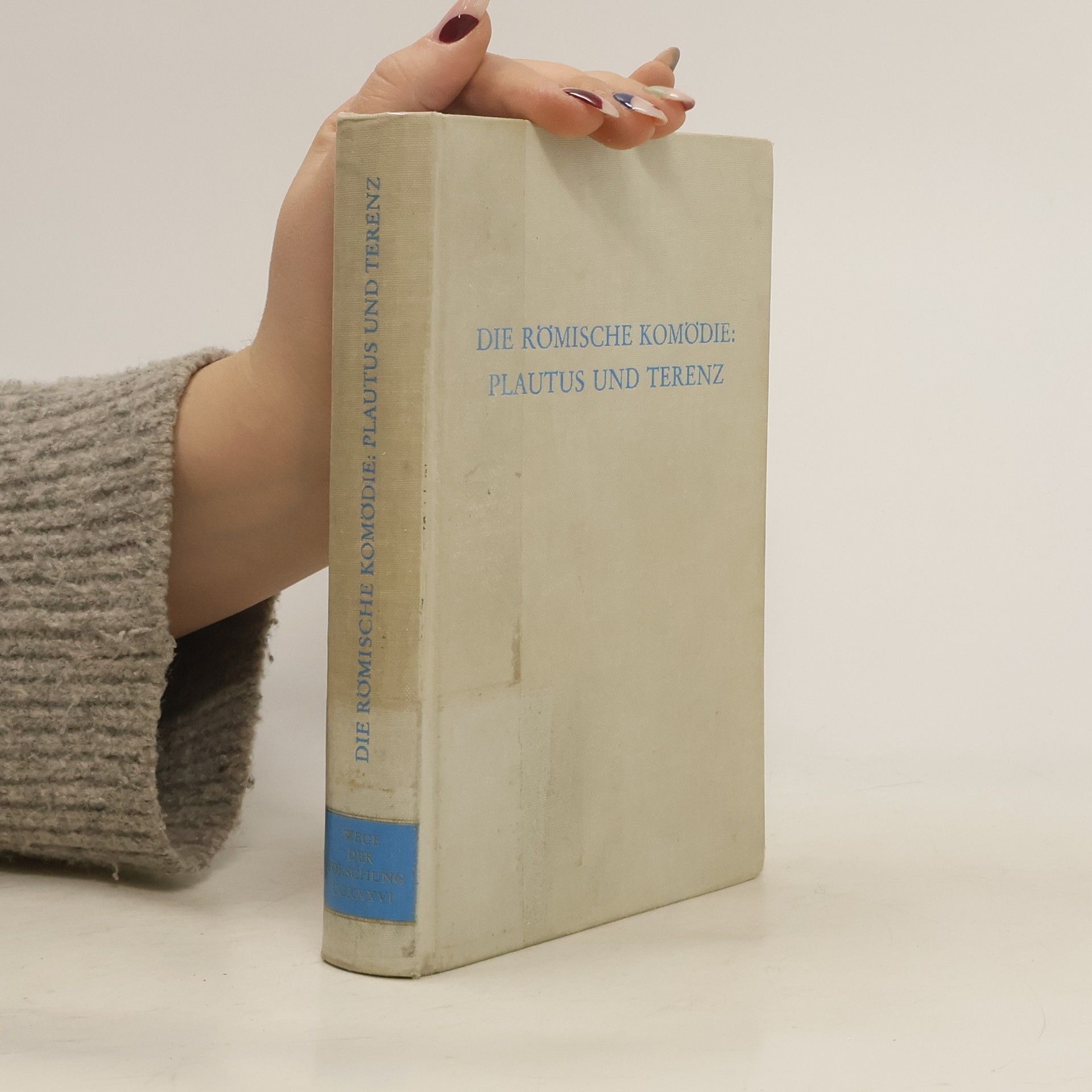
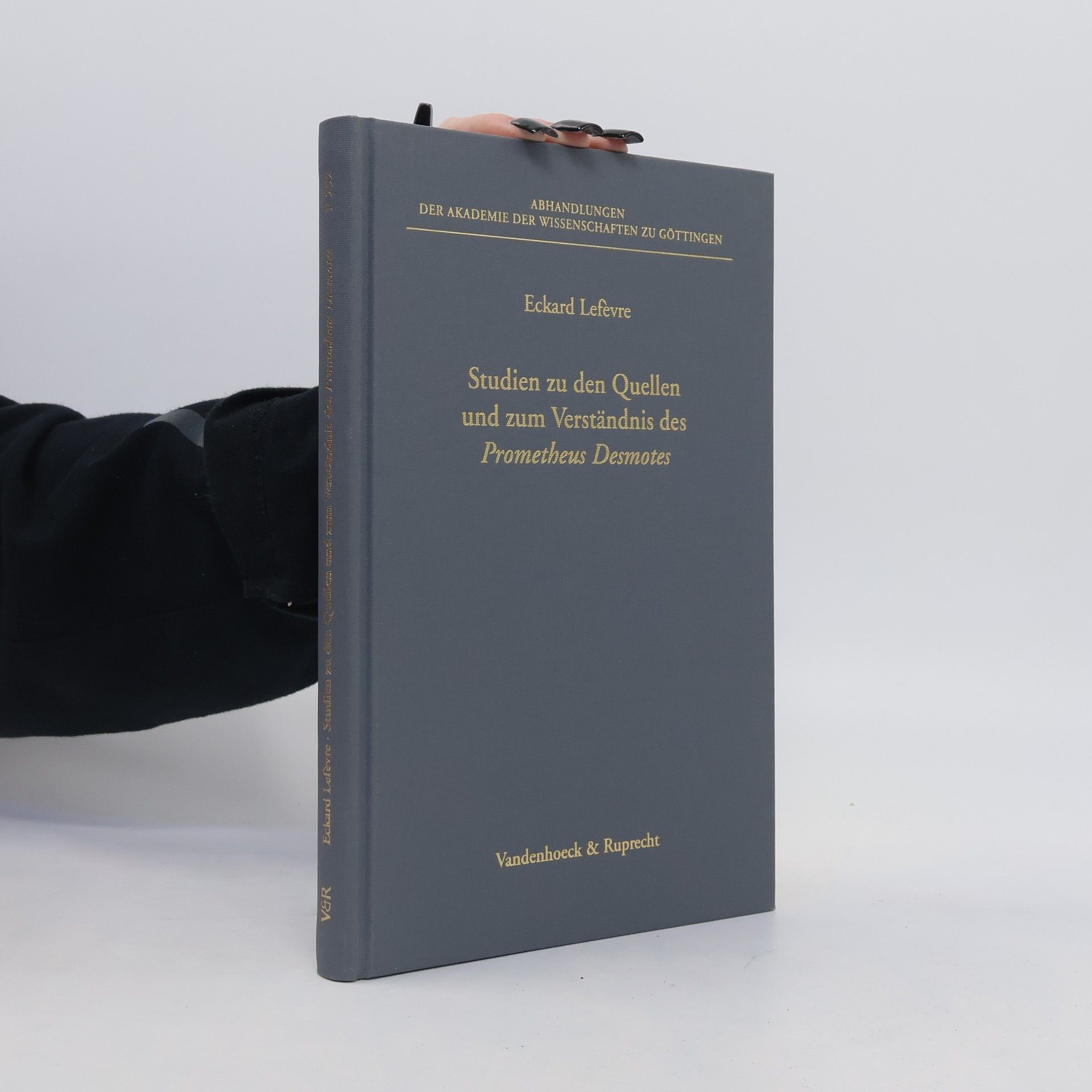

Unter Aischylos’ Namen ist die Tragödie ›Der Gefesselte Prometheus‹ (Prometheus Desmotes) überliefert. Aufgrund seiner ungewöhnlichen Struktur, der Sprache und des Weltbilds regen sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Zweifel an der Echtheit des Stücks. Der Autor versucht, seine Unechtheit und Abhängigkeit von mehreren aischyleischen Tragödien (darunter dem ›Gelösten Prometheus‹, Prometheus Lyamenos) zu erweisen. Dagegen wird nicht die Ansicht führender Forscher geteilt, auch der ›Gelöste Prometheus‹ und der ›Feuerbringer Prometheus‹ (Prometheus Pyrphoros) seien unecht. Es wird gezeigt, dass das Stück um 425 v. Chr. unter dem Einfluss der Sophistik entstanden ist.