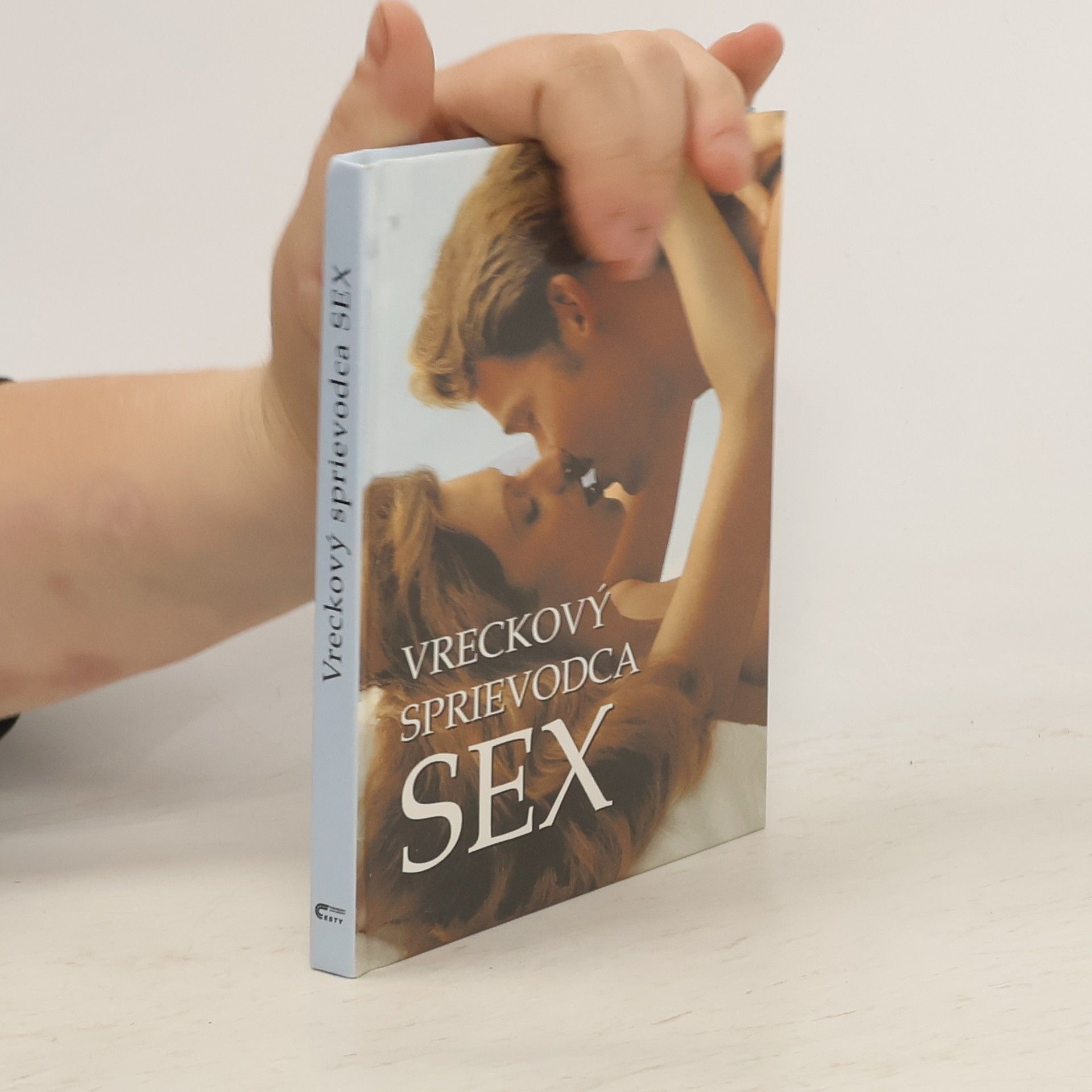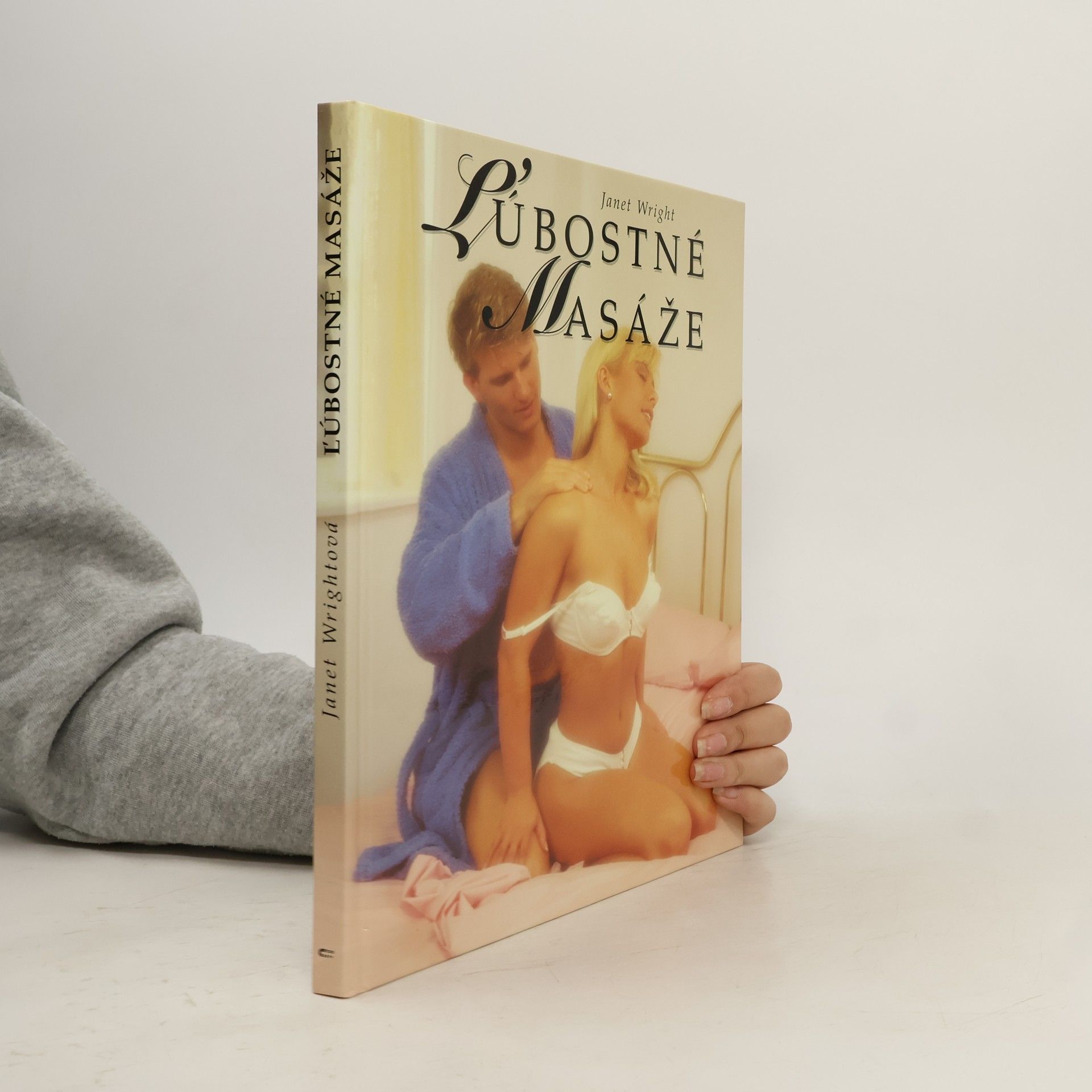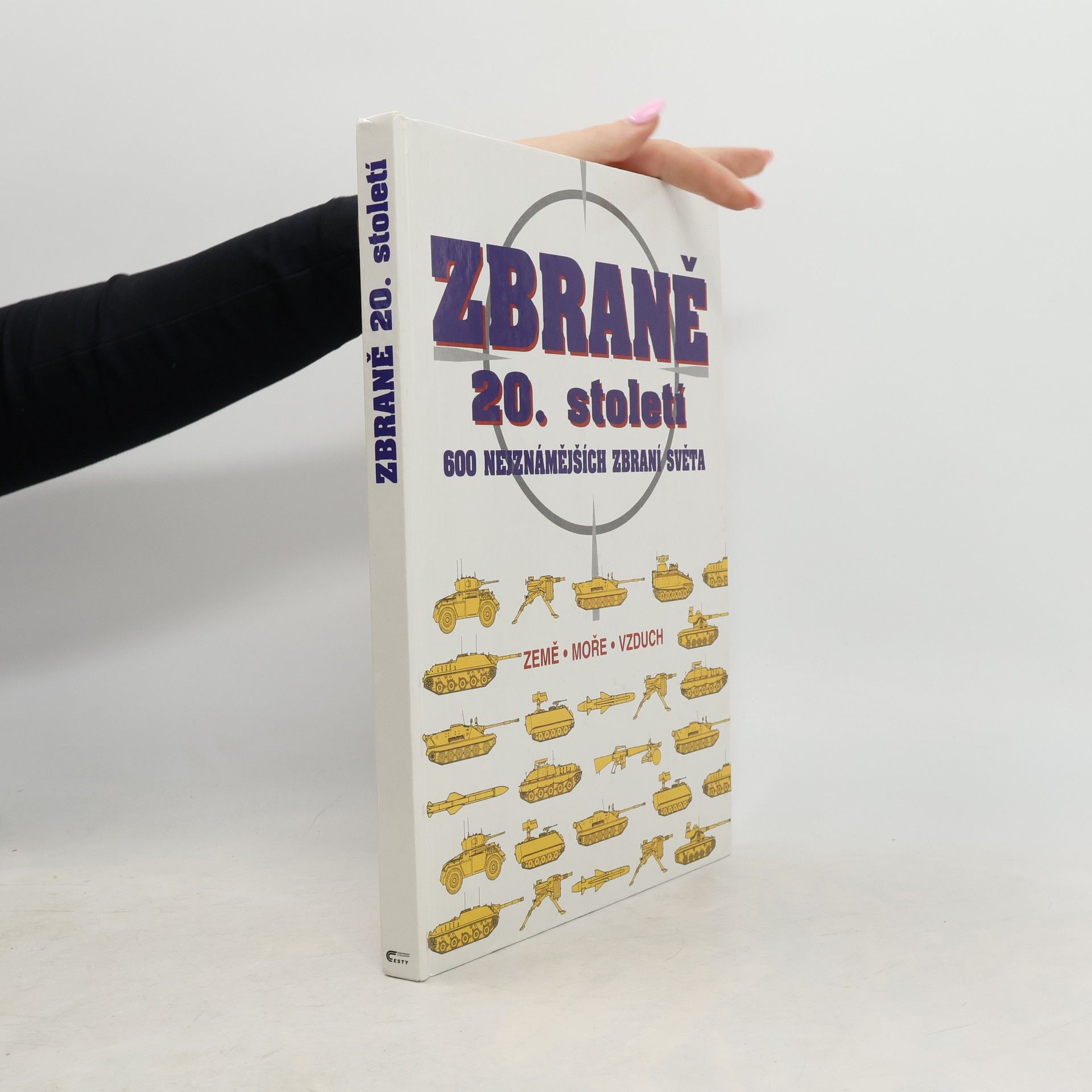Průvodce milenců
- 128 Seiten
- 5 Lesestunden
V této knize se dozvíte všechno, co na sexu zajímá ženy. Je to upřímné, otevřené a vtipné dílo, které zkoumá síly erotické přitažlivosti a všechny stránky milostného života od předehry až po dráždivé hry obrazotvornosti. Otevřeně popisuje jednotlivé polohy. Nechybějí údaje o potřebách ženského těla, ani rady, jak připravit prostředí pro milování a nápady, jak muži sdělit, co žena při sexu potřebuje. Průvodce milenců je kniha pro všechny: Pro dívky, které svůj milostný život teprve začínají, i pro ženy, jež se po rozchodu nebo dokonce rozvodu s partnerem necítí nejlépe, pro budoucí maminky, které zajímá, jak je to se sexem během těhotenství i pro dámy před přechodem. Zejména však pro ženy, které přemýšlejí, jak svůj pohlavní život okořenit a právě hledají různé náměty a nápady. Kniha je zaměřena na to, co moderní ženy od sexu a milostného vztahu očekávají. Je v ní všechno: • jak zlepšit sexuální vyvrcholení • jak realizovat oblíbené erotické představy • jak překonat zábrany • kde najít opravdové vzrušení.