Die Monografie untersucht das Thema der "Magie" im Spielfilm. Film und Kino als immanente Form des "Täuschungsvertrages" sind in ihrer historischen Entwicklung magischen Vorstellungen und insbesondere der Bühnenmagie vielfach verpflichtet. Die Analyse der filmischen Beispiele anhand thematischer Leitlinien (z. B. Konflikt, Pakt, Täuschung, Fluch) erlaubt es, Typen magischer Handlungen zu motivischen Clustern zu fassen.
Christa Agnes Tuczay Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

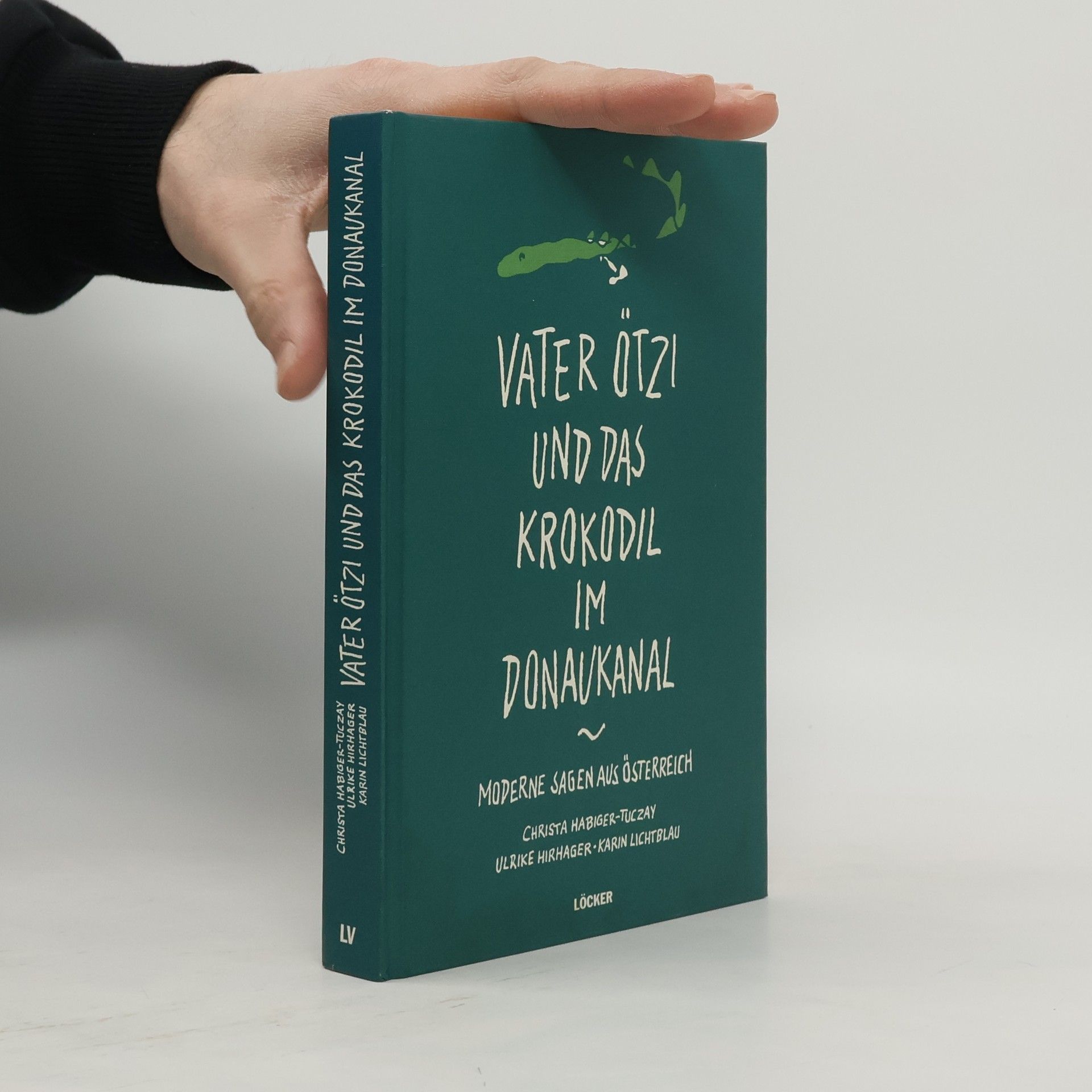




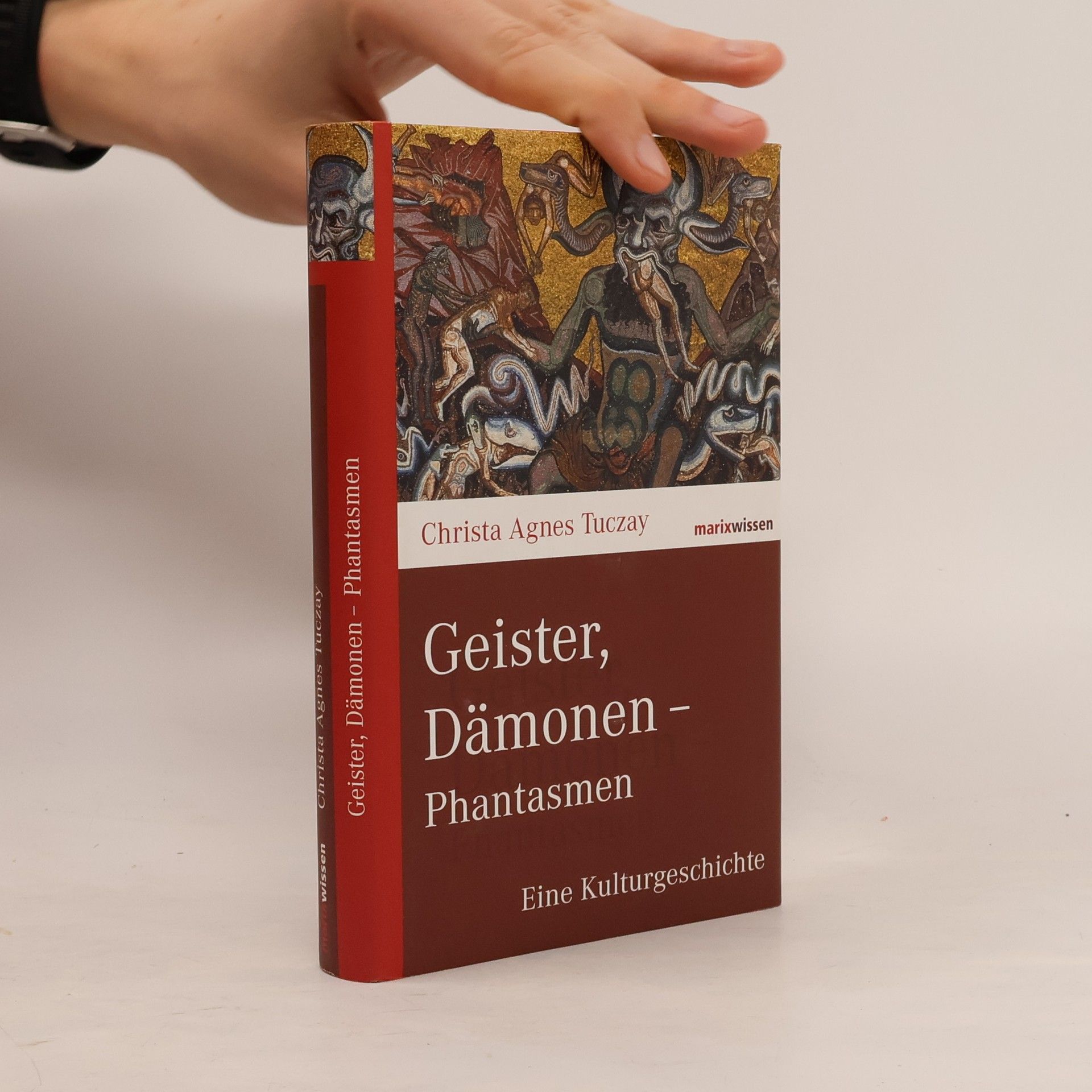
Wenn wir in der heutigen Zeit an Inspiration denken, fallen uns bekannte Zitate ein wie „Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf“ oder „Die Erkenntnis kam wie ein Blitz“. Umschreibungen wie diese weisen auf eine plötzliche Eingebung eines Wissens und Könnens hin, das offenbar geschlummert hat oder gar nicht erst vorhanden war. Im Mittelalter begreifen sich die solchermaßen Inspirierten als Werkzeuge Gottes, und bis in die Gegenwart bleibt die Überzeugung lebendig, dass das Hochwertigste in Literatur, Musik und den bildenden Künsten dem Einzelnen nicht frei verfügbar ist. Obwohl sich die vormoderne Prophetie und der Begriff der Inspiration stark an der Antike und vor allem an der Bibel ausrichtet, haben sich im Mittelalter mit der Frömmigkeitsbewegung neue Spielräume solcher „inspirierter“ Texte eröffnet. Gegenstand der Untersuchung sind deshalb mittelalterliche Offenbarungsliteratur, geistlich-prophetische, mystische und säkulare Texte. Die Studie richtet sich außerdem auf die mögliche Rezeption des paganen Modells des poeta vates und fragt damit nach einer mittelalterlichen Codierung und Kontextualisierung.
Die vorliegende Aufsatzsammlung ist aus der internationalen Tagung „Geschlecht ohne Körper. Gespenster im Kontext von Gender, Kultur und Geschichte“ (Spätherbst 2015) hervorgegangen, die sich vorgenommen hatte, einen oft zu wenig beachteten, wenn nicht sogar zumeist unterschlagenen Aspekt des Gespenstischen zu adressieren. Das Hereinholen der – je nach theoretischer Positionierung und diskursiver Steillage mehr oder minder umstrittenen – Thematik „Gender“ als gleichberechtigte Kategorie zu „Kultur“ und „Geschichte“ im Rahmen der Veranstaltung zeitigte eine entsprechende Bandbreite bei den verhandelten Beispielen, eben weil sich die benannten Kategorien zwar distinkt beschreiben lassen, in ihrer Wirksamkeit aber eine überschreitende Dynamik in den jeweiligen kulturellen Exempeln mit sich bringen. Verstärkt wurde auch die diskursive und kontextuelle Vermittlung der Gespenster-, Wiedergänger- und Phantasmen-Thematik in den neuen Medien in die Diskussion einbezogen, die in den rezenten Anthologien nur sporadisch aufgenommen wurde. Das Genre des Horrorfilmes und hier insbesondere das Subgenre des Gespenster- und Vampirfilms fungiert seit Jahren richtungsweisend für das Fortschreiben der Mythen und der wechselweisen Beeinflussung von Film und Literatur. (Aus der „Einleitung“)
Die Suche nach der Wahrheit, das Wissen um die Zukunft, die Lösung der Rätsel der Vergangenheit, die Beantwortung von brennenden Fragen – all das versprachen Orakel schon in der Antike. Das Aufkommen des Christentums bedeutete zwar einen Einschnitt, doch blühten die Wahrsagekünste, partiell nach antikem Vorbild in christianisierter Form weiter, aber auch genuin mittelalterliche Methoden bildeten sich heraus. Die von der Kirche nur widerwillig geduldeten geheimwissenschaftlichen Traktate, die sich mit Orakeltechniken befassten, waren immer wieder Verboten ausgesetzt, da die Theologen den Schicksalsglauben einerseits und die Beeinflussung der Wirklichkeit mit Hilfe der Magie andererseits als Ketzerei und Teufelsdienst verurteilten. Die widersprüchlichen Haltungen der Zeitzeugen beweisen, dass man nicht so einfach zwischen Gegnern und Anhängern der Wahrsagemethoden zu unterscheiden vermag, da die Widersprüche offenbar in den Personen selbst ausgetragen wurden. Dieses Buch bietet einen umfassenden kulturwissenschaftlichen Überblick aller mittelalterlichen Formen der Wahrsagerei und erweitert die bisherige Forschung um eine Perspektivierung der Rezeptions-, Diskurs- und Kontextgeschichte, ergänzt um einen Rückblick auf die Antike.
Geister, Dämonen – Phantasmen
Eine Kulturgeschichte
In vielen Kulturen und Religionen ist bis in die Gegenwart der Glaube an Geister und Dämonen präsent. Ob als Poltergeister, als namenlose Wesen aus alten Zeiten, die wegen bestimmter Vergehen als Geister ihr Dasein fristen müssen, oder als verstorbene Familienmitglieder, die ihre Nachkommen entweder durch ihre Anwesenheit schützen oder heimsuchen unzählige Geistererscheinungen haben auch in der Gegenwart ihren festen Platz im Alltagsleben vieler Menschen. Ebenso verhält es sich mit Dämonen, die häufig mit Besessenheit und (religiöser) Austreibung unter größten körperlichen und seelischen Qualen in Verbindung gebracht werden. Christa Agnes Tuczay entwirft eine ausführliche Kulturgeschichte der Geister- und Dämonengestalten von der Antike bis zur Gegenwart. Den Schwerpunkt bilden dabei Geister- und Dämonenvorstellungen in den drei monotheistischen Religionen Judentum, Islam und Christentum.
Staré dobré časy nebyly vždy tak idylické, jak se někteří lidé domnívají. Epidemie, hlad a morové nákazy vylidnily celé kraje a vždycky se našli jedinci, kteří si chtěli usnadnit život tím, že uzavřou pakt s ďáblem. Tak vstoupili na evropskou scénu i nechvalně proslulí požírači srdcí, odporní „sérioví vrazi“, jak bychom je nazvali dnes. Věřili, že pozřením srdcí druhých lidí se stanou neviditelnými. Jiná individua, například hraběnka Alžběta Báthoryová, soustředila svou zločineckou energii na nevinné děti. Vrchnost reagovala na tyto excesy pronásledováním a soudními procesy. Co to bylo za lidi? Rituální vrazi? Geniální zločinci? Nebo pouhé figurky využívané zmíněnou vrchností k cílené propagandě? Tato kniha vám nabízí jedinečnou sbírku fascinujících případů, které tvoří jakousi démonologii dunajské monarchie. V předmluvě známý kriminalista-biolog Mark Benecke uvádí několik případů ze současnosti, které vzbudily značnou pozornost u odborníků i laické veřejnosti.
Magie und Magier im Mittelalter
- 395 Seiten
- 14 Lesestunden
Die vielfältigen Aspekte der Magie, die einen der faszinierendsten Bereiche der mittelalterlichen Kultur und Geschichte darstellt. In den magischen Vorstellungen und Praktiken des Mittelalters werden neben den vielfältigen Traditionen aus der Antike, dem germanischen und dem keltischen Kulturkreis jüdische und arabische Einflüsse erkennbar, die sich insbesondere im Bereich des Geheimwissens zeigen. Die das abendländische Mittelalter beherrschende christliche Kirche hat einerseits schon früh begonnen, Zauberer, Hexen, Wahrsager und Alchimisten zu verfolgen, andererseits konnte sich die Magie einen Platz erobern, da sie bei der Christianisierung in verwandelter, scheinbar christlicher Gestalt mit in die neue Religion übernommen wurde. Es entwickelte sich sogar eine eigene sanktionierte Methode des Umgangs mit dem Übernatürlichen, die christliche Magie, die sich vor allem im Wunder und in der Teufelsaustreibung manifestierte und bis in die Neuzeit erhalten hat.

