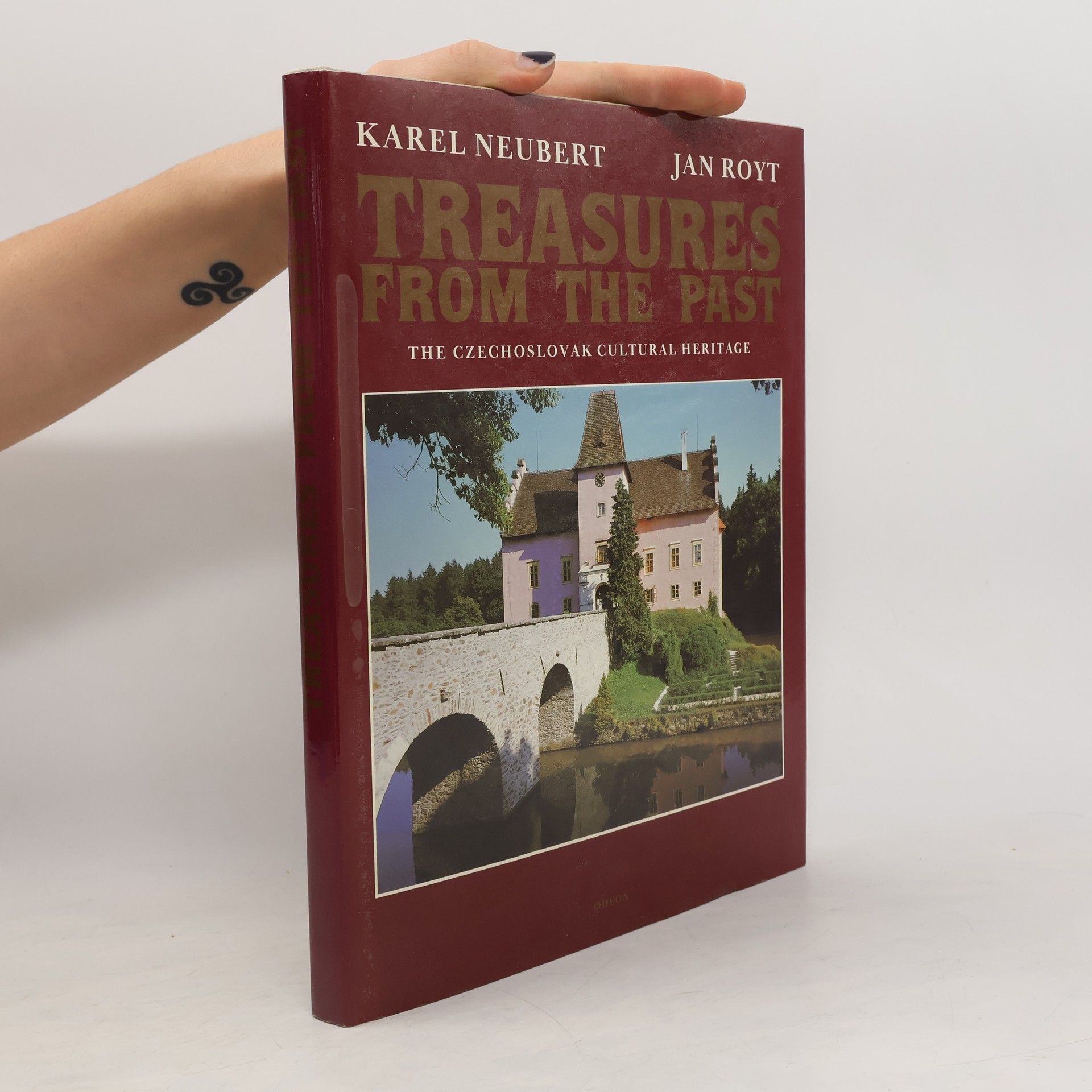Sachsen und Anhalt
Jahrbuch der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt
Die Beiträge in Band 35 (2023) behandeln u. a. die Themen „Arneburg, die Altmark und das ottonische Königtum“, „Mittelalterliche Gerichtsverfassung im Naumburger Westchor?“, „Der Bauernkrieg in Sachsen-Anhalt“, „Dorothea, Herzogin von Sachsen, Äbtissin von Quedlinburg (reg. 1610-1617)“, „Annäherungen an das dynastische Team der Grafen zu Stolberg-Wernigerode im 18. Jahrhundert“ und „Der 17. Juni 1953 in Magdeburg in der kollektiven Erinnerung“. Ein Werkstattbericht zu Künstlernachlässen in Sachsen-Anhalt, die Tätigkeitsberichte der Historischen Kommission 2019–2022 und des Instituts für Landesgeschichte 2021/22 sowie Besprechungen wichtiger Neuerscheinungen beschließen den Band.