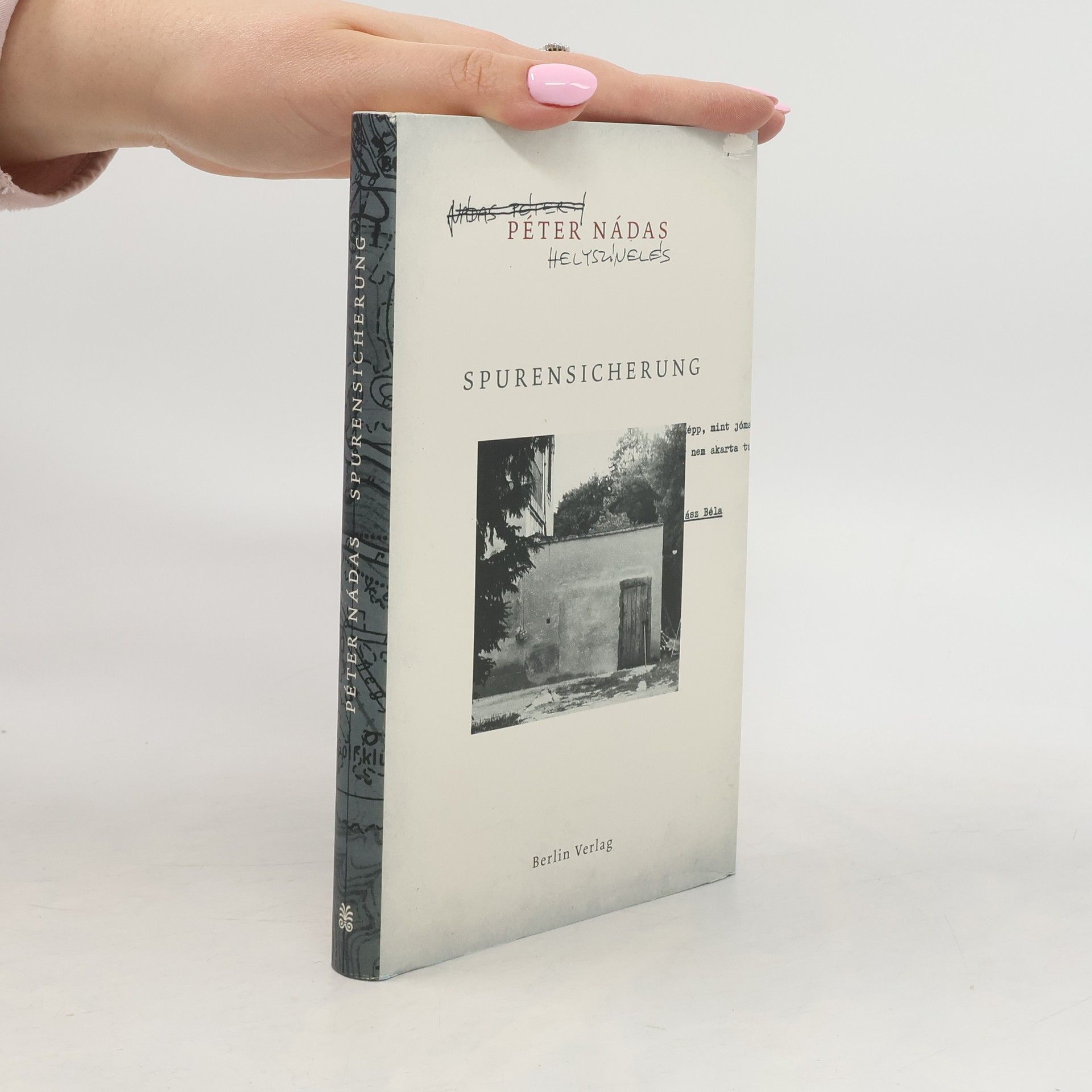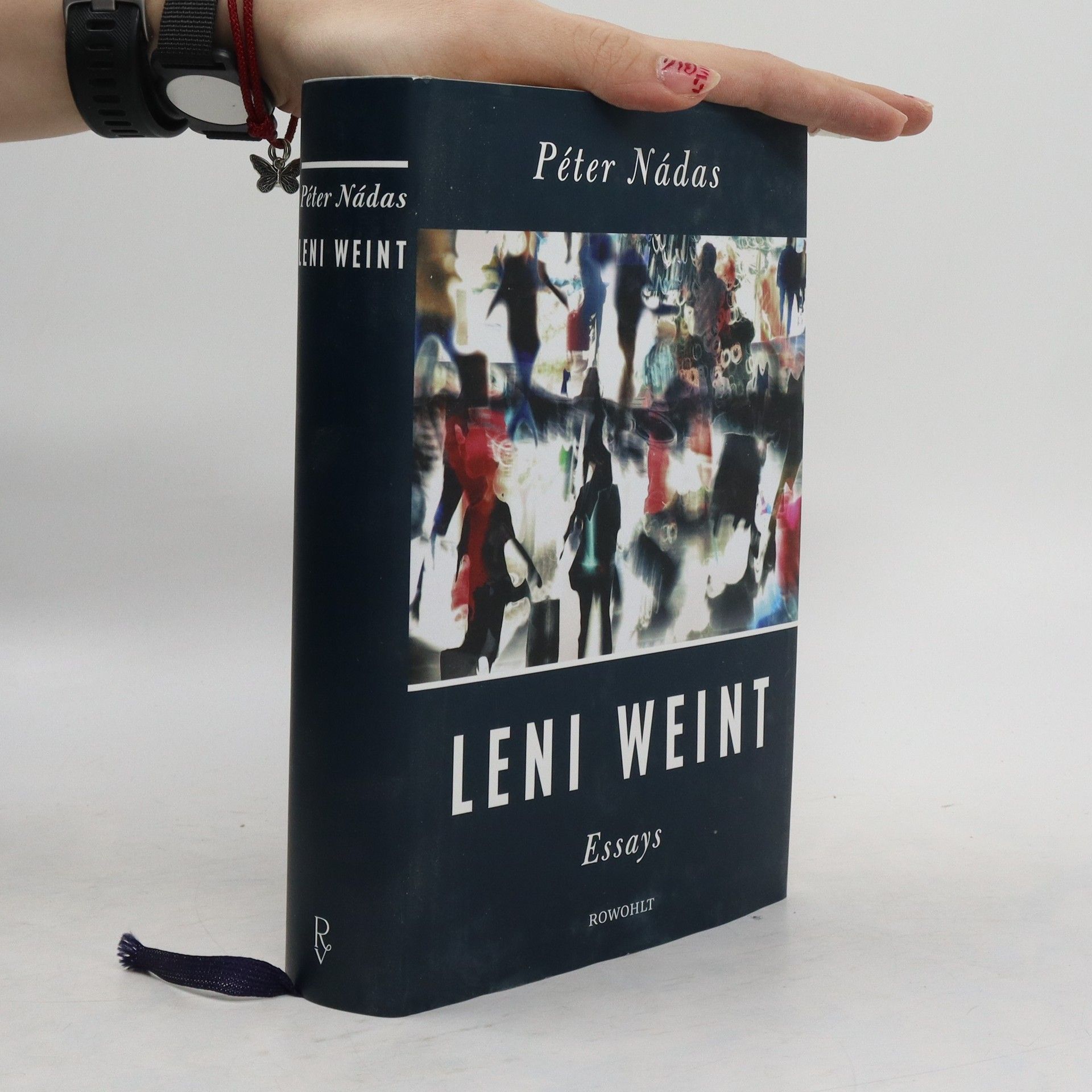Leni Weint
- 528 Seiten
- 19 Lesestunden
Vor dem Schreiben steht das Nichtschreiben – die Auseinandersetzung mit der Realität, die für Péter Nádas viele Dimensionen umfasst. Tägliche Reflexion über Träume, Alltagsbeobachtungen und ästhetische Erfahrungen ist für ihn unerlässlich, um zu beginnen. Diese Praxis hat neben seinen Erzählungen auch bedeutende Essays und Abhandlungen hervorgebracht, in denen er historische Verwerfungen und menschliche Abgründe beleuchtet. Die gesammelten Essays aus den Jahren 1989 bis 2014 reflektieren einen Zeitraum, der mit einem politischen Aufbruch in die Freiheit begann und mit einem Rückfall in den Populismus endete. Nádas analysiert, wie die Bürger Ungarns und anderer osteuropäischer Staaten erneut autoritär und nationalistisch regiert werden, und untersucht die Ursachen in den Katastrophen des 20. Jahrhunderts sowie in globalen Entwicklungen. Mit Scharfsinn und Leidenschaft thematisiert er anthropologische und moralische Fragen, Wahrheit und Lüge, Kunst und Verbrechen, Vertrauen und Täuschung. Ob es um die traumatische Erfahrung von Leni Riefenstahl, die osteuropäische Schattenwirtschaft oder die Folgen des 11. Septembers geht – sein intellektuelles Engagement verbindet sich stets mit literarischer Sensibilität.