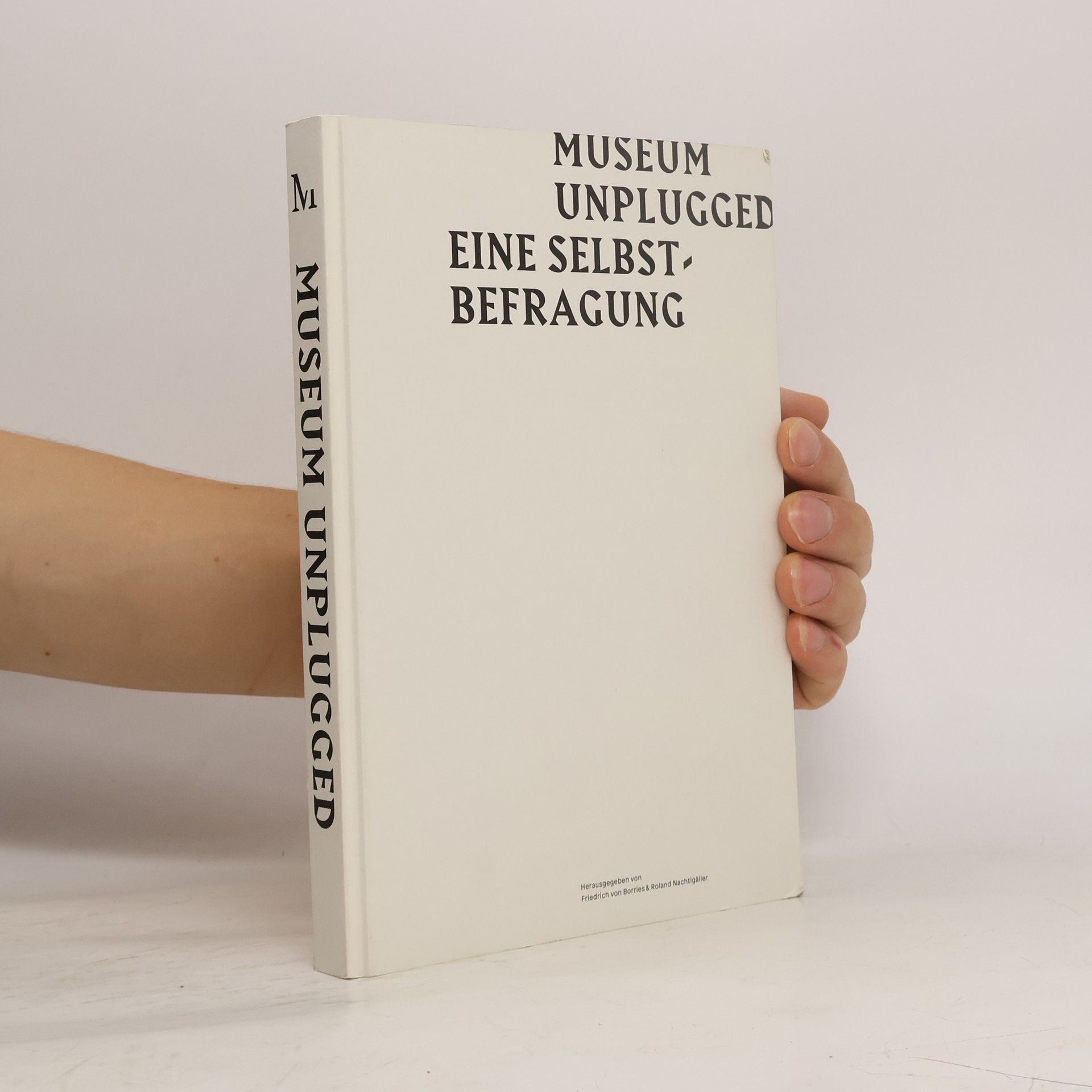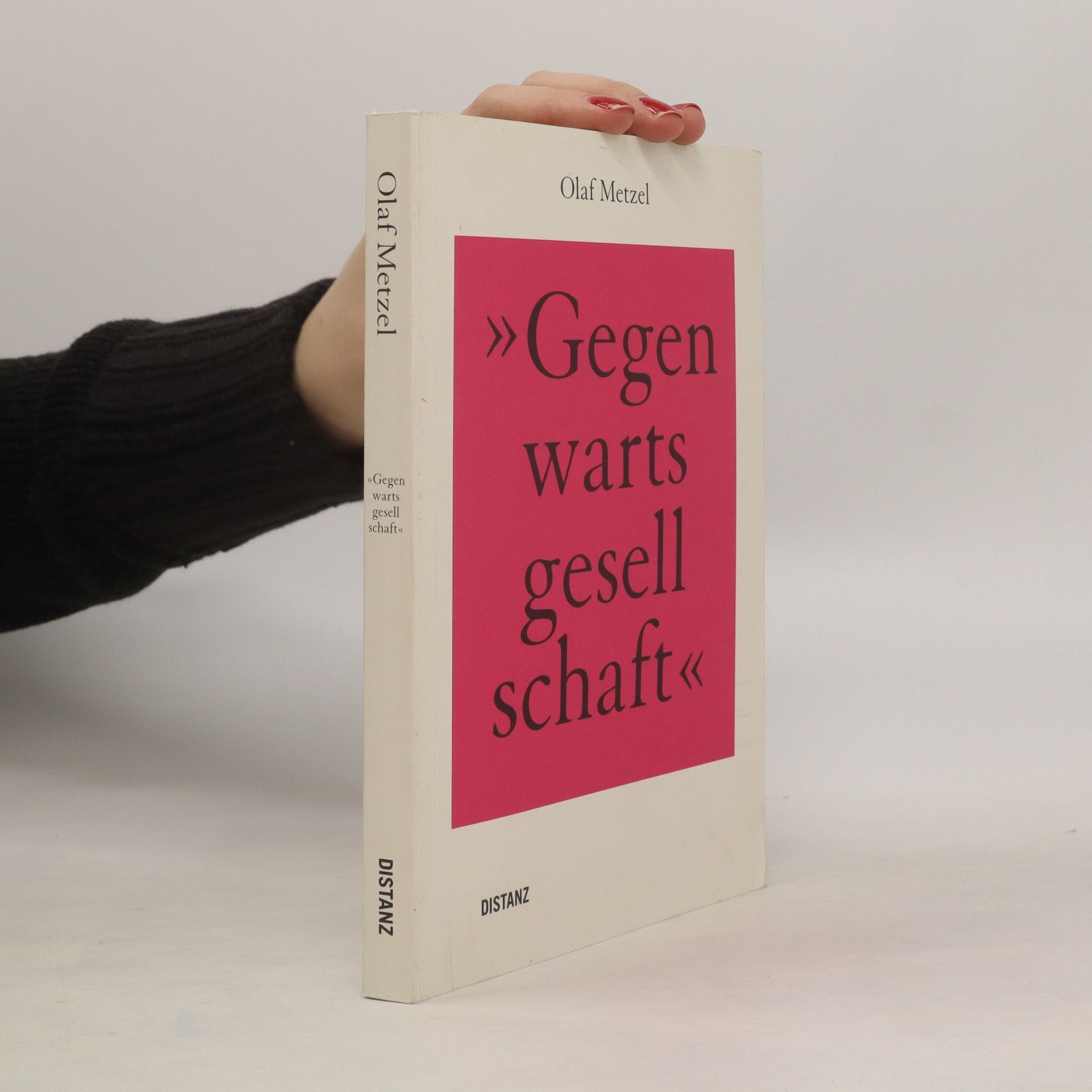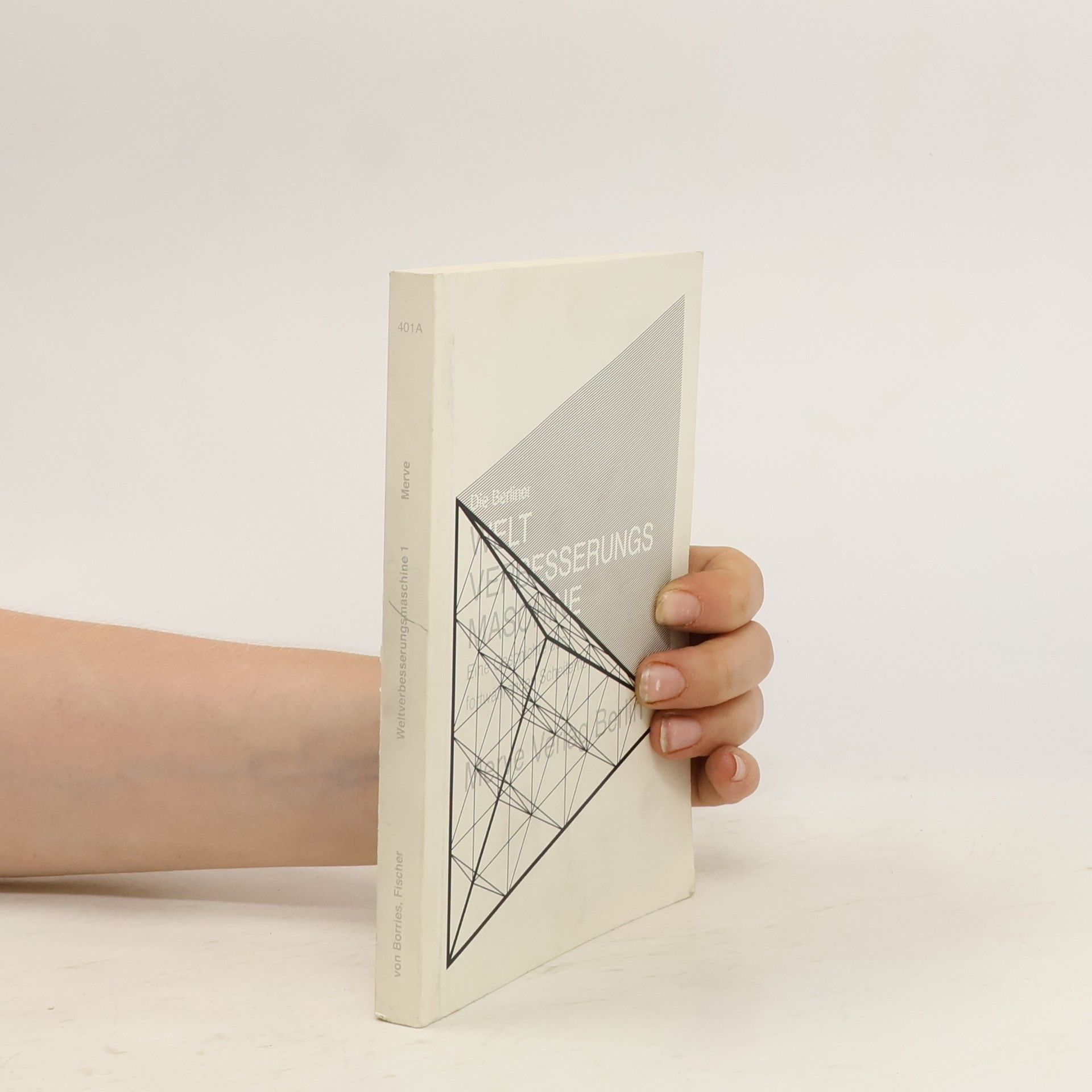Friedrich von Borries untersucht in seinem Buch die Perspektive zukünftiger Archäolog:innen, die Technofossilien analysieren, um unseren Umgang mit dem Klimawandel zu verstehen. Er hebt hervor, dass Objekte am Stadtrand, wie Müllverbrennungsanlagen und Serverparks, mehr über unsere Lebensweise verraten als zentrale Bauten und skizziert eine zukunftsorientierte Architektur.
Friedrich von Borries Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)


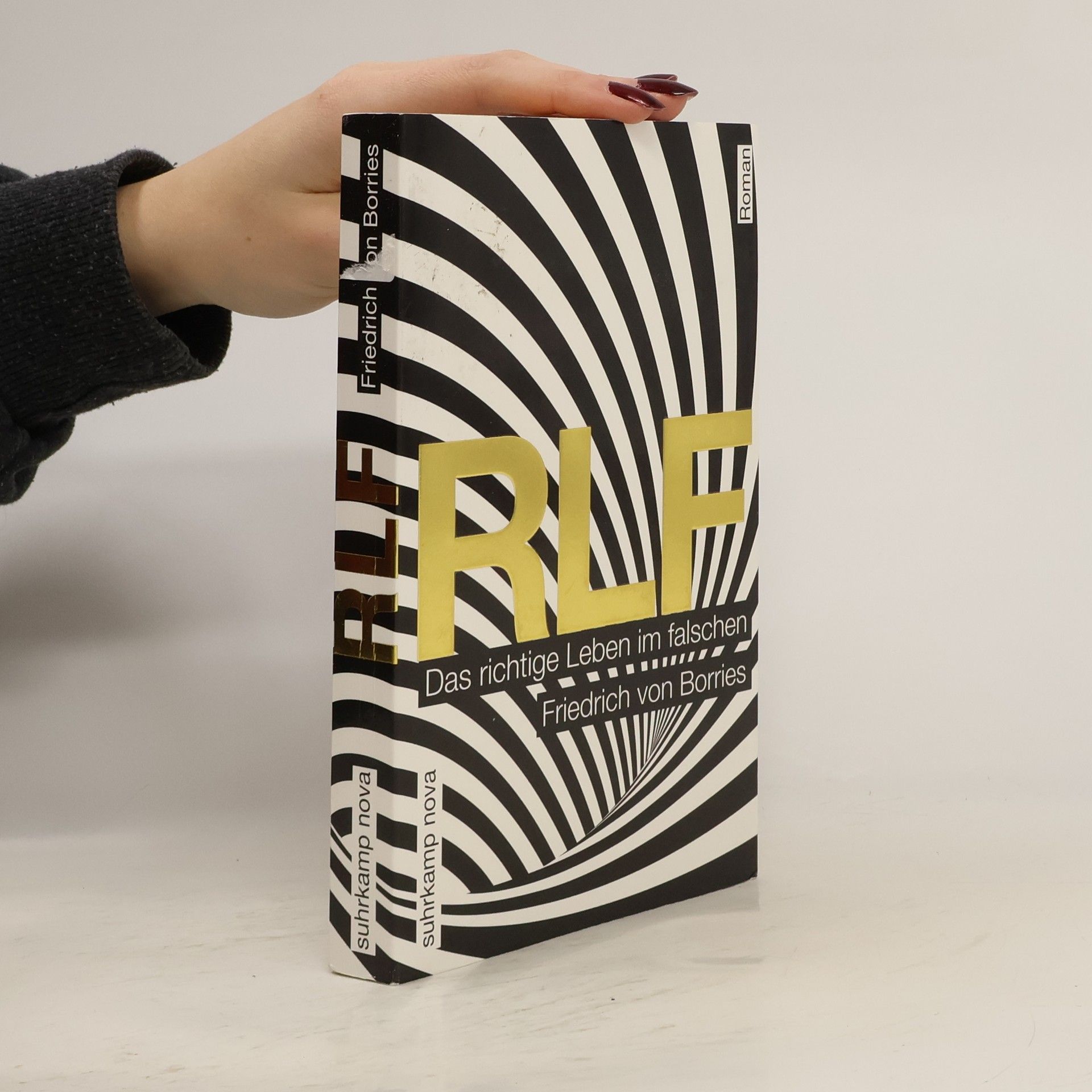

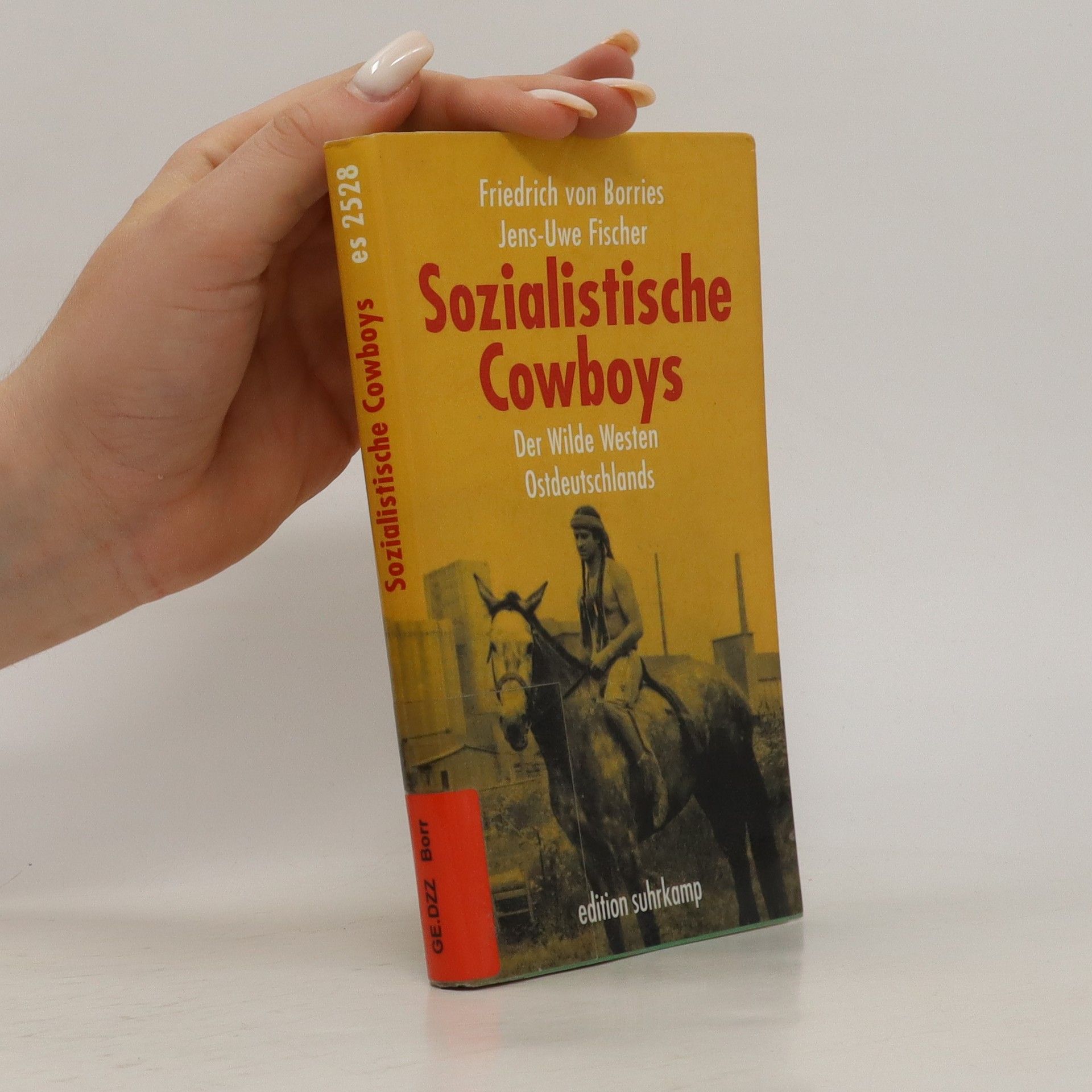
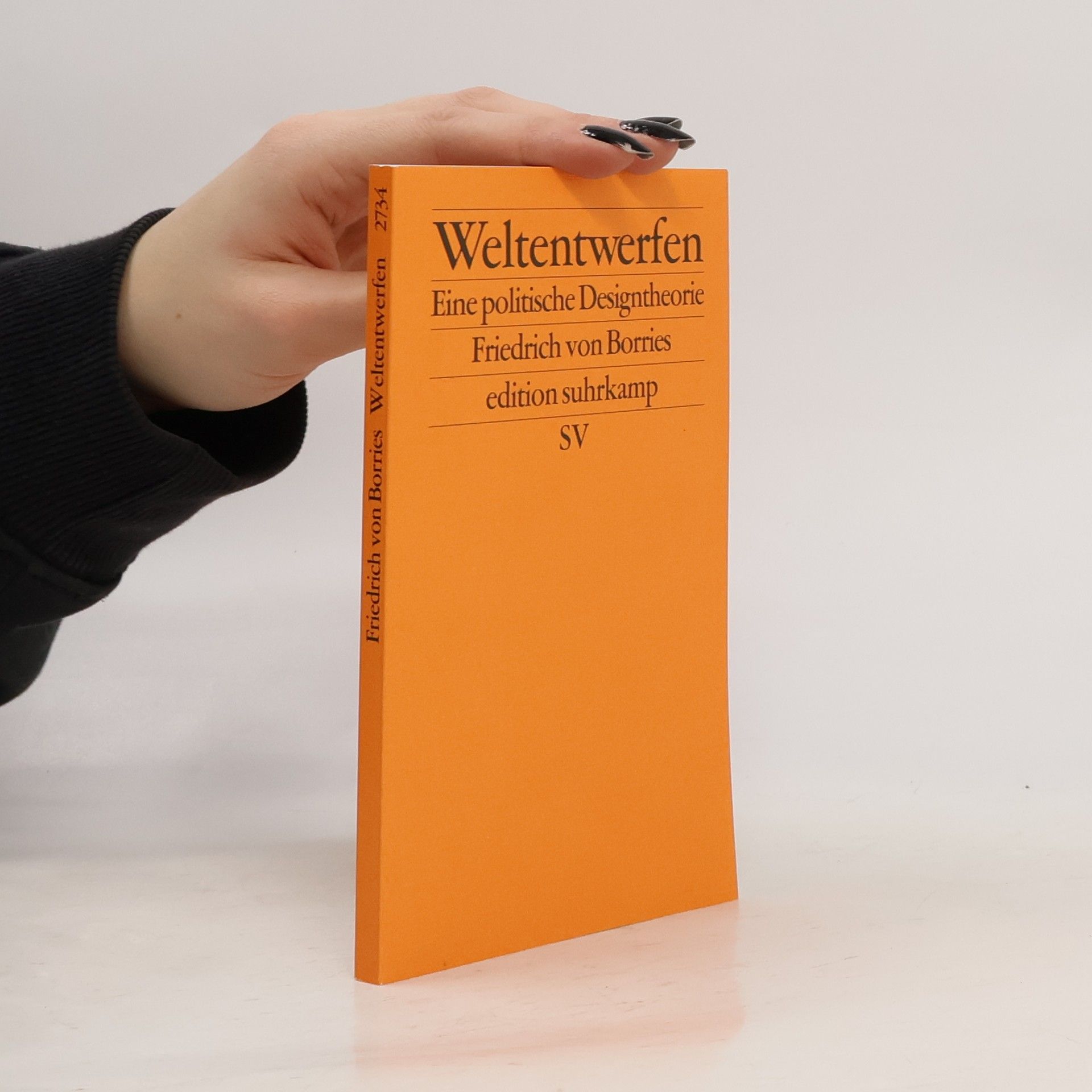

Das Funkhaus Nalepastraße, bis 1990 Sitz des Rundfunks der DDR und heute ein beliebtes Ausflugsziel, gilt als sein berühmtestes Werk. Begonnen hatte das bewegte Architektenleben Franz Ehrlichs (1907-1984) am Bauhaus in Dessau. 1937 wurde er als Widerstandskämpfer ins KZ Buchenwald gebracht, wo er das Tor mit der Inschrift »Jedem das Seine« gestalten musste. In der DDR nahm Ehrlichs Karriere Schwung auf – aber sein umfassender Geltungsanspruch kollidierte mit den politischen Leitlinien. Für ihren biographischen Essay begeben sich der Designtheoretiker Friedrich von Borries und der Historiker Jens-Uwe Fischer auf die Spuren eines lange vergessenen Bauhäuslers. Dabei reflektieren sie über die Widersprüche in Ehrlichs Biographie sowie die Ambivalenzen und den Totalitätsanspruch der Moderne.
Die Managerin Cornelia bittet den Kurator Florian, für die »Stiftung Nachhaltigkeit der Deutschen Industrie« ein Museum für ökologische Kunst zu entwickeln. Wie sähe ein Leben aus, das – im ökologischen Sinne – möglichst folgenlos bleibt? Florians Projekt bringt ihn mit der Künstlerin Lisa zusammen, die Bäume pflanzt, um daraus Holzkohle für ihre Installationen und Zeichnungen herzustellen – und damit in ihren Kunstwerken CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Er trifft John, der als radikaler Öko-Aktivist gegen die Kohleindustrie und die Abholzung des Goldbacher Forstes kämpft, den Flüchtling Issa, der Florians Selbstgewissheiten hinterfragt, die frustrierte PR-Frau Suzanna, die für die EU Umweltpolitik macht, aber lieber Bienen züchten will und den Bergmann Ronald, der Sorge um seinen Arbeitsplatz hat. Selbstüberschätzung trifft auf Lebensangst, Verzweiflung auf Hoffnung, Aktivismus auf Gewalt.Unerwartete Beziehungen entstehen, die im verschwenderischen »Fest der Folgenlosigkeit« ihren explosiven Höhepunkt finden.
Ausgehend von einer kritischen Gegenwartsanalyse entwerfen der Architekt Friedrich von Borries und der Stadtplaner Benjamin Kasten das Bild einer Stadt der Zukunft, die ökologischer und gerechter ist als die Stadt der Gegenwart. Sie ist größer und dichter, aber auch offener und grüner – und jeder Bewohner ist aktiv in ihre Gestaltung miteinbezogen. Anhand von Beispielen aus Architektur, Stadtplanung, Kunst und Design zeigen die Autoren, wo Aspekte dieser Zukunft schon jetzt erprobt werden: Von vertikalen Wäldern über unterirdische Plantagen, Selbstausbauhäuser und transnationale Grenzstädte bis hin zur Hochstraße in Seoul, die zum Park umgewidmet wurde. Ihre Darstellung ist gleichermaßen kritisch und kreativ, analytisch und visionär.
Weltentwerfen
Eine politische Designtheorie
Früher entwarfen Designer Gegenstände. Heute wird praktisch alles designt: das Klima, Prozesse, Flüchtlingslager. Wenn jedoch alles designt wird, ist es höchste Zeit, Design nicht länger allein nach ästhetischen Gesichtspunkten zu bewerten. Wir brauchen, so Friedrich von Borries, eine politische Designtheorie. Der Mensch ist gezwungen, die Bedingungen, unter denen er lebt, zu gestalten. Geschieht dies so, dass Handlungsoptionen reduziert werden, haben wir es mit Unterwerfung zu tun. In seinem Manifest plädiert von Borries für ein entwerfendes Design (des Überlebens, der Gesellschaft, des Selbst), das sich der totalitären Logik der Versicherheitlichung entzieht und gegen die Ideologie der Alternativlosigkeit neue Formen des Zusammenlebens imaginiert.
Museum unplugged - Eine Selbstbefragung
10 Jahre Marta Herford
RLF
- 251 Seiten
- 9 Lesestunden
RLF ist mehr als Lifestyle. RLF ist mehr als Kunst. RLF ist Widerstand. RLF kämpft für das richtige Leben im falschen. Werde Teil von RLF. Werde Shareholder der Revolution! Am Anfang stehen die Riots in London: Die Verlierer der Konsumgesellschaft strömen auf die Straßen, zeigen der Welt, dass es sie gibt; Autos und Geschäfte brennen. Und die Welt des jungen Werbers Jan gerät ins Wanken. Er hat mit Kampagnen für die Fashion-Industrie eine Menge Geld verdient, doch als er in die Unruhen gerät, wird ihm klar: Der Kapitalismus muss gestürzt werden und zwar mit seinen eigenen Mitteln. In der Aktivistin Slavia und dem Künstler Mikael Mikael findet Jan die richtigen Mitstreiter. Gemeinsam gründen sie RLF, ein Lifestyle-Unternehmen, das den Wunsch nach Protest und Widerstand in Konsumprodukte verwandelt; mit dem Ziel, das System selbst in einem revolutionären Akt zum Einsturz zu bringen. Doch die Revolution hat ihren Preis, und den wird am Ende jemand bezahlen müssen – und sei es mit dem Leben.
Olaf Metzel (geb. in 1952 in Berlin, lebt und arbeitet in München) ist ein deutscher Bildhauer und Objektkünstler. Provokation als Denkanstoß ist für ihn Teil seiner Kunst. Für seine Skulpturen verwendet er auch Teile, die als Schrott gelten, wie Absperrgitter bei der Arbeit 13.04.1981 1987 in Berlin oder ausrangierte Stadionsitze beim Fußball-Projekt Auf Wiedersehen 2006 in Nürnberg. In beiden Fällen kam es zu erheblichen Protesten in den jeweiligen Städten. Die vorliegende Publikation konzentriert sich ausschließlich auf die skulpturalen Arbeiten, die unterschwellige oder bewusst verdrängte Aspekte der deutschen Geschichte thematisieren. Neben zentralen Skulpturen wie Wurfeisen und Zwille (Entwurf Hafenstraße), 1990/91, Idealmodell PK/90, 1987, und Noch Fragen?, 1998/2013, werden auch neue und ortspezifische Arbeiten präsentiert. Sie zielen auf eine direkte Auseinandersetzung mit den Betrachtern und ihrem sozialen, urbanen und gesellschaftspolitischen Umfeld. Die Beiträge in diesem Textbuch setzen die Arbeiten von Olaf Metzels in einen Kontext unterschiedlicher politischer, architektonischer und kunsttheoretischer Diskurse. Sie stammen von Friedrich von Borries, Felix Ensslin, Günther Jacob, Olaf Metzel, Raimar Stange, Florian Waldvogel und Regina Wamper
Die Berliner Weltverbesserungsmaschine
Eine Geschichte des fortwährenden Scheiterns
Seit dem 17. Jahrhundert existiert in verschiedenen europäischen Metropolen der geheime Plan, eine Weltverbesserungsmaschine zu errichten. Diese Idee beruht auf der Annahme, dass die richtige Anordnung von Kunstwerken und Artefakten in einer architektonischen Superform eine mächtige Kraft entfalten könnte. Sie inspirierte sowohl absolutistische Machtphantasien als auch aufklärerische Weltverbesserungsansprüche. Der Bau der Maschine galt als gemeinsame Aufgabe der Wissenschaften und Künste. Um im europäischen Wettbewerb nicht zurückzufallen, gründete der preußische Staat die Akademie der Künste (1696), die Akademie der Wissenschaften (1700) und später die Königlichen Museen zu Berlin (1830). Diese Institutionen widmeten sich der wissenschaftlichen und künstlerischen Forschung, während die Museen die notwendigen Bauteile sammelten. Doch Ende des 19. Jahrhunderts scheiterte das Langzeitvorhaben endgültig, und das Geheimprojekt geriet in Vergessenheit. Der erste Band des Forschungsvorhabens dokumentiert die Geschichte dieses Projektes, während der zweite Band einen kritischen Rekonstruktionsversuch aus dem Sommer 2013 präsentiert, der im Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart und 15 weiteren Berliner Museen gezeigt wurde. Dieses Projekt ist eine Kooperation der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der HFBK Hamburg, gefördert von der Schering-Stiftung und der Jungen Akade
Weil Design die Welt verändert, machen wir ...
- 255 Seiten
- 9 Lesestunden
Design ist ein fester Bestandteil der modernen Welt. Lebens- und Kommunikationsmittel, Räume, Möbel, Kleider. Obwohl so ziemlich alles, was uns im Alltagsleben begegnet, gestaltet ist, sind theoretische Auseinandersetzungen mit dem Thema Gestaltung im deutschsprachigen Raum rar. Dabei gewinnt die Thematik nicht nur an Präsenz, sondern auch an Bedeutung, Verantwortung und Komplexität. Während Design einst vor allem funktionieren musste, soll es heute zusätzlich noch inspirieren, definieren, vermitteln, differenzieren und verbessern. Weil Design die Welt verändert. trägt mit einer anregenden Sammlung von interdisziplinären Projekt- und Textbeiträgen dazu bei, den gestaltungsspezifischen Diskurs im deutschen Sprachraum zugänglich und verständlich zu machen. Die von den Herausgebern Friedrich von Borries und Jeszko Fezer ausgewählten Beiträge stammen von Designern wie Enzo Mari, Roberto Feo und Peter Raacke, zeitgenössischen Künstlern wie Anselm Reyle und Ion Sorvin. Ergänzend werden die historischen Positionen eines Joseph Beuys, Max Bill und Dieter Rams im Kontext der aktuellen Debatten neu reflektiert und so entsteht eine kurzweilige und gehaltvolle Positionsbestimung.